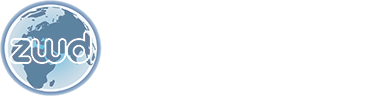. Der Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums zur Reform der Telekommunikationsüberwachung ist bei Branchenverbänden und Bürgerrechtsorganisationen „als in weiten Teilen verfassungswidrig“ abgelehnt worden. Das Bundesjustizministerium wies die Kritik zurück.
„Der Entwurf betrifft die Branche doppelt“, betont die Lobbyvereinigung Bitkom in einer Stellungnahme. Die Auflage zur Vorratsspeicherung von Telefon- und Internetdaten bedeute „eine weitere Aushöhlung des grundrechtlich geschützten Fernmeldegeheimnisses.“ Damit sinke das Vertrauen der Nutzer in die Verlässlichkeit elektronischer Kommunikationsmittel, was auch der Wirtschaft schade.
27 NGOs kritisieren Datensvorratsspeicherung
Ebenfalls heftig umstritten ist die Datenvorratsspeicherung von Telefon, Handy, E-Mail und Internet, wie sie das Justizministerium anstrebt.
27 zivilgesellschaftliche Organisationen bezeichneten es in einer gemeinsamen Erklärung vom 22. Januar als „inakzeptabel“, dass ohne jeden Verdacht einer Straftat sensible Informationen über die sozialen Beziehungen, die Bewegungen und die individuelle Lebenssituation der über 80 Millionen Bundesbürger erfasst werden sollen. Unterstützer der Stellungnahme, die unter der Federführung des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung entstanden ist, sind unter anderem Journalisten- und Verlegerverbände, der Chaos Computer Club, der Verband der deutschen Internetwirtschaft eco sowie der Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Nutzen der Speicherung ist fraglich
Den angeblichen Nutzen einer Vorratsdatenspeicherung stellen die Verbände infrage. Aus einer Studie des Bundeskriminalamts ergebe sich, dass eine solche pauschale Überwachungsmaßnahme die durchschnittliche Aufklärungsquote „von derzeit 55 Prozent im besten Fall auf 55,006 Prozent erhöhen“ könne. In Irland und anderen Staaten, wo die Provider die Verbindungs- und Standortdaten bereits über Jahre hinweg speichern müssen, sei die Kriminalitätsrate nicht ersichtlich gesunken. Die Sicherheit der Bevölkerung werde so nicht gestärkt, beklagen die Vereinigungen, während die Massendatenvorhaltung der freiheitlichen Gesellschaft schade.
Bitkom: Justitzministerium verletzt EU-Recht
Die Bitkom rügte zudem mehrere Punkte, an denen das Justizministerium entgegen einem Beschluss des Bundestags über die Vorgaben der entsprechenden EU-Richtlinie hinausgehen will. Der Entwurf erstrecke die Speicherpflicht etwa auch auf Firmen, die „an der Erbringung der Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit mitwirken“.
Für „kaum nachvollziehbar“ hält der Bitkom so die Schätzung des Ministeriums, wonach die Kosten der verpflichteten Privaten zur Umsetzung der umfangreichen zusätzlichen Speicherauflagen zu vernachlässigen und eine erweiterte Entschädigung der Hilfssheriffs unnötig sei. Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass „die Anpassung und Erweiterung von Software und Prozessen einen wesentlichen Teil der zusätzlichen Kosten verursachen werden.“ Zusammen mit dem „Totalausschluss der Investitionskosten“ widersprächen die Pläne den verfassungsrechtlichen Vorgaben.
Auch heute schon vage Überwachungsanfragen
Schon heute erreichten die TK-Firmen verstärkt „vage gefasste Auskunftsersuchen", in denen die zeitliche und räumliche "Eingrenzung" allein durch Übersendung eines Auszugs aus dem Fahrplan der Deutschen Bahn oder durch Autobahnabschnitte „im Raum Bielefeld über den Zeitraum von drei Monaten" vorgenommen werde. „Solche Auskunftsersuchen erwecken den Anschein, als sei die Erhebung von Telekommunikationsdaten erster Ermittlungsansatz und nicht bereits Resultat von durch Vorermittlungen erhärteten Verdachtsmomenten“.
Dass die eingeschalteten Unternehmen künftig nur noch prüfen sollen, ob die ersuchende Stelle im Einzelfall legitimiert und zuständig sei, laufe den straf- und datenschutzrechtlichen Verpflichtungen zuwider.
Ministerium wehrt sich
Das Justizministerium erklärte hingegen, „wir werden einen verfassungsgemäßen Entwurf vorlegen“, so ein Sprecher gegenüber der Presse. Der Referentenentwurf halte sich an die Vorgaben der EU-Richtlinie und bewege sich mit einer sechsmonatigen Speicherzeit am unteren Rand der Bandbreite
„Der Entwurf betrifft die Branche doppelt“, betont die Lobbyvereinigung Bitkom in einer Stellungnahme. Die Auflage zur Vorratsspeicherung von Telefon- und Internetdaten bedeute „eine weitere Aushöhlung des grundrechtlich geschützten Fernmeldegeheimnisses.“ Damit sinke das Vertrauen der Nutzer in die Verlässlichkeit elektronischer Kommunikationsmittel, was auch der Wirtschaft schade.
27 NGOs kritisieren Datensvorratsspeicherung
Ebenfalls heftig umstritten ist die Datenvorratsspeicherung von Telefon, Handy, E-Mail und Internet, wie sie das Justizministerium anstrebt.
27 zivilgesellschaftliche Organisationen bezeichneten es in einer gemeinsamen Erklärung vom 22. Januar als „inakzeptabel“, dass ohne jeden Verdacht einer Straftat sensible Informationen über die sozialen Beziehungen, die Bewegungen und die individuelle Lebenssituation der über 80 Millionen Bundesbürger erfasst werden sollen. Unterstützer der Stellungnahme, die unter der Federführung des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung entstanden ist, sind unter anderem Journalisten- und Verlegerverbände, der Chaos Computer Club, der Verband der deutschen Internetwirtschaft eco sowie der Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Nutzen der Speicherung ist fraglich
Den angeblichen Nutzen einer Vorratsdatenspeicherung stellen die Verbände infrage. Aus einer Studie des Bundeskriminalamts ergebe sich, dass eine solche pauschale Überwachungsmaßnahme die durchschnittliche Aufklärungsquote „von derzeit 55 Prozent im besten Fall auf 55,006 Prozent erhöhen“ könne. In Irland und anderen Staaten, wo die Provider die Verbindungs- und Standortdaten bereits über Jahre hinweg speichern müssen, sei die Kriminalitätsrate nicht ersichtlich gesunken. Die Sicherheit der Bevölkerung werde so nicht gestärkt, beklagen die Vereinigungen, während die Massendatenvorhaltung der freiheitlichen Gesellschaft schade.
Bitkom: Justitzministerium verletzt EU-Recht
Die Bitkom rügte zudem mehrere Punkte, an denen das Justizministerium entgegen einem Beschluss des Bundestags über die Vorgaben der entsprechenden EU-Richtlinie hinausgehen will. Der Entwurf erstrecke die Speicherpflicht etwa auch auf Firmen, die „an der Erbringung der Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit mitwirken“.
Für „kaum nachvollziehbar“ hält der Bitkom so die Schätzung des Ministeriums, wonach die Kosten der verpflichteten Privaten zur Umsetzung der umfangreichen zusätzlichen Speicherauflagen zu vernachlässigen und eine erweiterte Entschädigung der Hilfssheriffs unnötig sei. Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass „die Anpassung und Erweiterung von Software und Prozessen einen wesentlichen Teil der zusätzlichen Kosten verursachen werden.“ Zusammen mit dem „Totalausschluss der Investitionskosten“ widersprächen die Pläne den verfassungsrechtlichen Vorgaben.
Auch heute schon vage Überwachungsanfragen
Schon heute erreichten die TK-Firmen verstärkt „vage gefasste Auskunftsersuchen", in denen die zeitliche und räumliche "Eingrenzung" allein durch Übersendung eines Auszugs aus dem Fahrplan der Deutschen Bahn oder durch Autobahnabschnitte „im Raum Bielefeld über den Zeitraum von drei Monaten" vorgenommen werde. „Solche Auskunftsersuchen erwecken den Anschein, als sei die Erhebung von Telekommunikationsdaten erster Ermittlungsansatz und nicht bereits Resultat von durch Vorermittlungen erhärteten Verdachtsmomenten“.
Dass die eingeschalteten Unternehmen künftig nur noch prüfen sollen, ob die ersuchende Stelle im Einzelfall legitimiert und zuständig sei, laufe den straf- und datenschutzrechtlichen Verpflichtungen zuwider.
Ministerium wehrt sich
Das Justizministerium erklärte hingegen, „wir werden einen verfassungsgemäßen Entwurf vorlegen“, so ein Sprecher gegenüber der Presse. Der Referentenentwurf halte sich an die Vorgaben der EU-Richtlinie und bewege sich mit einer sechsmonatigen Speicherzeit am unteren Rand der Bandbreite