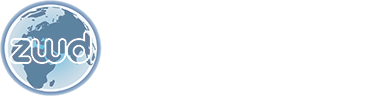Schulstrukturdebatte
Gesamtschulplätze fehlen
zwd Berlin - Die Schulstrukturdebatte bekommt zunehmend Schwung, ohne dass das zentrale Element beim Namen genannt wird. In Erinnerung an Grabenkämpfe der Vergangenheit wird der Begriff „Gesamtschule“ von PolitikerInnen streng gemieden, aber genau das fordern sie. Umschrieben wird das längere gemeinsame Lernen mit „Schule für alle“ oder „integrative Systeme“. Welcher Name sich letztlich durchsetzen wird, ist aber unerheblich. Entscheidend ist, dass sich nach und nach einzelne Landesverbände, Bundesorganisationen und Gremien von SPD und B´90/Grüne (der zwd berichtete) sowie gesellschaftliche Gruppen und Verbände gegen das gegliederte Schulsystem aussprechen. Stärkstes Argument für den weiteren Ausbau von Gesamtschulen ist neben den Empfehlungen von Bildungs-ExpertInnen letztlich der Elternwille: Allein in sechs vom Gesamtschulverband (GGG) untersuchten Ländern fehlen über 20.000 Plätze für langes gemeinsames Lernen - jede dritte Anmeldung musste mangels Kapazität abgelehnt werden. Hochgerechnet auf das ganze Bundesgebiet müssten, wie eine zwd-Länderumfrage ergab, rund 400 neue Schulen für knapp 300.000 SchülerInnen eingerichtet werden. Wie andere Staaten individuelle Förderung in heterogenen Lerngruppen betreiben, untersucht ein EU-Projekt, das Dr. Anne Ratzki in einem Gastbeitrag für den zwd vorstellt.
Ganztagsschulen
„Der Zug hat Fahrt aufgenommen“
zwd Berlin - Das größte Schulentwicklungsprogramm der deutschen Geschichte zeigt erste Wirkung: Am 11. Mai konnte Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn die Einrichtung von über 3.000 neuen Ganztagsschulen allein für die Förderjahre 2003/2004 vermelden. Nach einem „schleppenden Anfang“ im vergangenen Jahr, beteiligen sich inzwischen alle 16 Bundesländer an dem Ausbauprogramm. Rückenwind bekommt die Ministerin auch von den Eltern, die laut einer aktuellen Umfrage massiv den Ausbau fordern.
Blickpunkt
Überflüssig, bitte streichen
zwd (ja) - Es wird mehr Geld geben für Bildung, Forschung und Entwicklung. Was bislang als Forderung eher Raum in Feiertagsreden fand als in der politischen Realität, ist jetzt zum Greifen nah. Der Kanzler hat sich festgelegt: Von seinem Vorhaben, den Wandel zu einer zukunftsfähigen Wissensgesellschaft einzuleiten, kann er nicht mehr abrücken - er hat es zum zentralen Thema seiner weiteren Amtszeit erklärt. Um das zu schaffen, braucht er viel Geld. Beschlossene Sache ist es in der SPD-Führung, in diesem Jahr noch die Abschaffung der Eigenheimzulage in Angriff zu nehmen. Auch andere Subventionsstreichungen werden dieser Tage in Berlin diskutiert. Heftige Kritik erntete Wolfgang Clement für seinen Vorschlag, den Sparerfreibetrag zu kürzen, andere wollen die Steinkohleförderung zurückschrauben (CDU/CSU) oder die Pendlerpauschale kappen sowie Flugbenzin besteuern (B´90 / Grüne). Politisch durchsetzbar wird aber wohl am ehesten der Kanzler-Vorschlag zur Streichung der Eigenheimzulage sein. Wozu auch, fragt man sich, müssen bei einem Überangebot an Wohnraum und einer rückläufigen Bevölkerungszahl zusätzliche Neubauten subventioniert werden bei einer gleichzeitigen Abrissförderung in Ostdeutschland? Die Ministerpräsidenten der Länder jedenfalls werden es sich sorgfältig überlegen, ob sie die Initiative im Bundesrat blockieren. Mit Einsparungen für Bund und Länder von bis zu zehn Milliarden Euro jährlich rechnet jedenfalls Schröder. Mittel, die unmittelbar in Wissenschaft, Forschung und Entwicklung fließen könnten.
Diese Ausgabe herunterladen