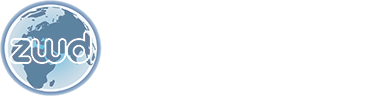Niedersachsen kündigt Abkommen
KMK vorläufig vor dem Aus
Wulff im Kreuzfeuer parteiübergreifender Kritik – „Leichtfertiger Frontalangriff auf ein unverzichtbares Gremium
zwd Berlin - In scharfer Form haben Bildungspolitiker quer durch alle Parteien auf die Entscheidung des niedersächsischen Landeskabinetts reagiert, das Länderabkommen über das gemeinsame Sekretariat der Kultusministerkonferenz aufzukündigen. Die hessische Kultusministerin und Vizepräsidentin der KMK, Karin Wolff (CDU), sprach von einem „leichtfertigen Frontalangriff auf ein unverzichtbares Koordinierungsgremium“ und wies zugleich die Angriffe des niedersächsischen Ministerpräsidenten, Christian Wulff (CDU), gegen die Arbeit des KMK-Sekretariats zurück. Würde das KMK-Sekretariat aufgelöst, käme das einem Rückfall in Kleinstaaterei gleich, weil die bisher dort erledigten Dienstleistungen künftig von jedem Land selbst vorgehalten werden müssten. Die Ministerin warf dem niedersächsischen Regierungschef vor, durch einseitige Vertragskündigungen den internen Reformprozess der KMK zu unterlaufen und einer Bundesbehörde für Bildung Vorschub zu leisten. Ähnlich kritisch hatte sich auch die baden-württembergische Kultusministerin, Annette Schavan (CDU), geäußert. Zwischen Schavan und Wulff war es wegen der niedersächsischen Pläne dem Vernehmen nach im CDU-Präsidium zu einem heftigen Zusammenstoß gekommen. CDU und CSU befürchten negative Folgen für die Bemühungen der Bundesstaats-Kommission: „Ohne die KMK wäre alles Sprechen über den Föderalismus und seine künftige Entwicklung obsolet“, schrieb die CDU-Politikerin Wolff ihrem Parteifreund Wulff ins Stammbuch. Die Kultusministerkonferenz will nach den Worten ihrer Präsidentin, der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Doris Ahnen (SPD), auf ihrer nächsten Plenarsitzung am 14./15. Oktober die Chancen für die weitere Geschäftsgrundlage des Gremiums ausloten, dessen Geschäftsstelle nach der Kündigung binnen Jahresfrist als aufgelöst gilt.
Blickpunkt
Einstieg in den Ausstieg?
zwd Potsdam - Bis zuletzt hieß es in der brandenburgischen SPD, die sechsjährige Grundschule sei nicht verhandelbar. Jetzt ist es doch anders gekommen. Nur noch „im Regelfall“, so die Botschaft aus der Potsdamer Koalitionsrunde, würden Kinder nach der 6. Klasse auf das Gymnasium wechseln. Die Ausnahme - Leistungs-profilklassen für besonders begabte Kinder - wird durch Eignungstests und am Ende auch zahlenmäßig gestärkt. Verfechter der sechsjährigen Grundschule befürchten nun den Einstieg in den Ausstieg aus diesem besonderen Schulmodell. Die Grundschule wird auch sonst CDU-Vorstellungen weiter angenähert: Kopfnoten für Verhalten soll es schon ab Klasse 2 geben. Beschlossene Sache ist ferner das Abitur nach Klasse 12, was den Druck auf die Grundschulen erhöht. Um den Konsequenzen des drastischen Schülerrückgangs in den neuen Ländern Rechnung zu tragen, wollen die Koalitionäre unter Führung von SPD-Ministerpräsident Matthias Platzeck und CDU-(noch-) Innenminister Jörg Schönbohm die bisherigen Real- und Gesamtschulen in einem neuen Sekundarschultyp zusammen führen, der ähnlich wie zu DDR-Zeiten nun den Titel „Oberschule“ tragen wird. Auf diese Weise haben SPD und CDU die wichtigsten Streitpunkte in Potsdam erfolgreich umschifft. Ein neuer Bildungsminister aus der SPD soll es richten. Der bisherige Amtsinhaber, der erst 44jährige Steffen Reiche, ein Urgewächs aus der Gründergeneration der DDR-SPD, muss seinen Stuhl räumen.
Diese Ausgabe herunterladen