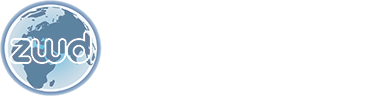PISA 2003
Keine Ruhe vor dem Sturm
zwd Berlin - Wer die ersten Ergebnisse der PISA-2003-Studie an die Öffentlichkeit gebracht hatte, ist nicht bekannt. Obwohl nur wenige, und noch dazu: wenig überraschende, Zahlen Gegenstand der Indiskretion waren, lösten die Vorabmeldungen über das diesmalige Abschneiden der 15-Jährigen in Deutschland erneut heftige Diskussionen über die Wirksamkeit der durch die Kultusministerkonferenz beschlossenen Bildungsreformen aus. Nach den zentralen Neuerungen in der Folge des ersten PISA-Schocks, Bildungsstandards, mehr Ganztagsschulen und Qualitätssicherung, rücken nun die Förderung von Kindern bildungsferner Schichten mit Migrationshintergrund sowie zunehmend auch Schulstrukturfragen in den Mittelpunkt der Debatten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft will jetzt den Druck erhöhen für das längere gemeinsame Lernen. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat sich bereits einen gutachterlichen Wegweiser für die schrittweise Überwindung des gegliederten Schulsystems erstellen lassen.
Gastbeitrag: Dr. Dieter Wunder
„Ein schwerer Rückschlag für die Gesamtschule“
zwd Potsdam - Die Koalitionsfraktionen in Brandenburg haben bereits zu Beginn der neuen Legislaturperiode den Entwurf für eine Schulgesetz-Novelle in den Landtag eingebracht. Schwarz-Rot übernimmt damit „das Schulmodell Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen, verwendet dafür unbegründet einen neuen Namen (den fünften dieser Schulform nach Mittel-, Regel-, Regionale und Sekundarschule; ‚Oberschule’ war in der Zeit nach 1945 etwa in Berlin und Hamburg für die differenzierte Einheitsschule üblich) und zementiert das zweigliedrige Schulsystem für den größten Teil der ehemaligen DDR“, schreibt der ehemalige GEW-Vorsitzende Dr. Dieter Wunder, Mitglied in der Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stiftung und im Sachverständigenrat Bildung der Hans-Böckler-Stiftung in einem Gastbeitrag für den zwd über die neue Schulform in Brandenburg.
Blickpunkt
Die soziale Frage gestellt
zwd Berlin (ja) - Die soziale Frage hat den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag, Friedrich Merz, bewegt, als er zum Auftakt der Haushaltsdebatte an das Rednerpult im Plenarsaal trat. Die Bundesregierung betreibe mit einer Rekordverschuldung von 43,5 Milliarden Euro Politik auf Kosten der Kinder. Dem Finanzminister warf er „asoziale Politik“ vor. Daher will sich Merz - kommenden Generationen verpflichtet - für eine Neudefinition und damit für die Eingrenzung des Investitionsbegriffes stark machen. Schließlich denke die Bundesregierung darüber nach, diesen auf Bildungsausgaben auszudehnen. Wer wollte ihm nicht beipflichten: Die wachsende Schuldenlast ist eine schwere Hypothek für unsere Kinder, der Abbau staatlicher Verbindlichkeiten eine gesamtgesellschaftliche Pflicht. Aber: Wieviel kann eine Volkswirtschaft in Zeiten des wirtschaftlichen Minimalwachstums sparen und an welcher Stelle? Schulen und Hochschulen jedenfalls können keine weiteren Einschnitte verkraften. Bildungsausgaben sind Investitionen in die Zukunft, mit Konsum hat das wenig zu tun. Die OECD rechnet damit, dass in Deutschland jeder für Bildung zusätzlich augegebene Euro eine positive Rendite bringt - für den Einzelnen und für die Volkswirtschaft. Die Erträge würden allerdings erst langfristig eingefahren. Kurzfristig könnte ein entschlossener Subventionsabbau helfen, auch gegen die Neuverschuldung. Der bedarf aber der Zustimmung der Union. Die soziale Bedeutung einer Bauförderung, die überwiegend Besserverdienenden zugute kommt, ist jedenfalls begrenzt. Auch Merz´ Parteifreund, der saarländische Ministerpräsident Peter Müller, weiß das inzwischen.
Diese Ausgabe herunterladen