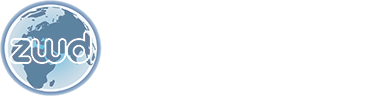zwd Berlin (bie) – Akademikerinnen verdienen sich als Putzhilfen ihren Unterhalt, jede siebte Mutter erzieht ihre Kinder ohne Vater und jährlich werden bis zu 15.000 Frauen von ihren Männern umgebracht. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat sich die Rolle von Russlands Frauen stark geändert. Tiefgreifende gesellschaftspolitische Umbrüche und die Wirtschaftskrise der 90-er Jahre haben sich auch auf das Geschlechterverhältnis ausgewirkt. Dauerhafter Stress und Verarmung sowie Drogen- und Alkoholmissbrauch kennzeichnen auch den Familienalltag. Die Mehrzahl der Frauen hat sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. In Russland ist die Politik fest in den Händen der Männer, vielen Frauen gilt sie sogar als schmutziges Geschäft.
Die Politik ist fest in Männerhand
Nach den politisch bewegten Jahren der Perestroika hat das Interesse an Politik und die Beteiligung am politischen Gestalten des Landes unter Frauen drastisch abgenommen. In einer landesweiten Befragung der Friedrich-Ebert-Stiftung gaben über die Hälfte der Frauen an, dass Männer mehr Rechte und Möglichkeiten in der aktiven Politik hätten, obwohl insgesamt die Aussichten von Frauen, am gesellschaftlichen und politischen Leben teil zu haben, gestiegen seien. Der Blick in die politischen Institutionen genügt, um zu sehen, dass die Politik in Russland männlich ist.
In der Kommunalpolitik werden Frauen zwar zunehmend erfolgreicher und sie besetzen zahlreiche Leitungsfunktionen in nicht-staatlichen Organisationen. Allerdings traut die Mehrheit der WählerInnen den Frauen nicht zu, sich in der großen Politik zu behaupten. Im Gegenteil: Der Frauenanteil in politischen Führungspositionen schrumpft stetig.
Seit 1999 sind gerade einmal 34 von 450 Abgeordneten in der Duma Frauen. In der ersten Legislaturperiode nach dem Fall der Sowjetunion waren immerhin noch 13,6 Prozent der Duma-Abgeordneten weiblich, in der zweiten 11,4 Prozent, jetzt beläuft sich die Zahl auf lediglich 7,2 Prozent. Damit belegt Russland den 80. Platz auf der Liste der Länder, in denen Frauen im Parlament vertreten sind - nach Liberia und der Ukraine.
Unter den neun StellvertreterInnen des Duma-Vorsitzenden ist gerade einmal eine Frau, von 29 Ausschussvorsitzenden zwei Frauen: Swetlana Gorjatschewa (Fraktion der Kommunistischen Partei) ist Vorsitzende des Ausschusses für Frauen, Jugend und Familie und Valentina Piwenko (Abgeordnetengruppe Volksdeputat) ist Vorsitzende des Ausschusses für Probleme des russischen Nordens und Fernen Ostens.
Frauenquote ist unerwünscht
Auch die Exekutive brüstet sich nicht gerade mit weiblichem Personal. Die stellvertretende Premierministerin Valentina Matwejenko, zuständig für Soziales und Kultur, ist Russlands einzige Frau in der Regierung.
Die Betonung einer spezifisch weiblichen Politik lehnt die Mehrheit der Russinnen ab. Dies ist vielleicht der Grund, dass bei der vergangenen Duma-Wahl 1999 die Frauenunion Russlands und die Partei der Verteidigung der Frauen lediglich zwei bzw. 0,8 Prozent der Stimmen erreichten. Allerdings orientierten sich diese auch stark an der alten Kommunistischen Partei und setzten sich für einen Militäreinsatz in Tschetschenien ein, den viele Russinnen ablehnen.
Einzelne Frauenorganisationen und Politikerinnen haben in den vergangenen Monaten immer wieder das Thema Quote auf die politische Tagesordnung gesetzt. In der Bevölkerung stößt diese Idee bei den Frauen jedoch auf wenig Gegenliebe: Nur ein Viertel der Frauen spricht sich für die Quote aus.
Dabei hatte es zu Zeiten der Sowjetrepublik eine Geschlechterquote im Parlament gegeben: Eine Quote von 33 Prozent Frauen wurde von den Komitees der KpdSU im Obersten Sowjet festgelegt, darüber hinaus wurde bestimmt, wie viele Vertreterinnen der Arbeiterklasse oder Akademikerinnen entsandt wurden. Doch dieser Anteil sagte nichts über den tatsächlichen Einfluss von Frauen aus. Führungspositionen besetzte kaum eine Frau, im Parlament waren sie häufig nur für kurze Zeit vertreten und konnten sich daher nicht so gut etablieren wie ihre männlichen Parteigenossen. Das hat sich auch im demokratischen System nicht verändert.
Bis heute sind die Parteien in Russland in männlicher Hand: Lediglich zwei Prozent der Mitglieder politischer Parteien sind Frauen.
Trotzdem hat sich in den Jahren der Transformation ein weibliches Gegengewicht gebildet, dass für eine gleichberechtigte Teilhabe an der Demokratie streiten will. Konkrete Lebensgeschichten zeigen das Leben in dem größten Land der Erde, wie es unterschiedlicher kaum sein könnte. Von der russischen Frau zu sprechen scheint gerade zu unmöglich. Der zwd hat sich anlässlich der Frankfurter Buchmesse in einer Spezialausgabe „Frauen in Russland“ auf weibliche Spurensuche begeben in einem Land zwischen Aufbruch und Stagnation.
Bestellen Sie hier die 24-seitige Spezialausgabe „Frauen in Russland“ zum Preis von 5 Euro.
Die Politik ist fest in Männerhand
Nach den politisch bewegten Jahren der Perestroika hat das Interesse an Politik und die Beteiligung am politischen Gestalten des Landes unter Frauen drastisch abgenommen. In einer landesweiten Befragung der Friedrich-Ebert-Stiftung gaben über die Hälfte der Frauen an, dass Männer mehr Rechte und Möglichkeiten in der aktiven Politik hätten, obwohl insgesamt die Aussichten von Frauen, am gesellschaftlichen und politischen Leben teil zu haben, gestiegen seien. Der Blick in die politischen Institutionen genügt, um zu sehen, dass die Politik in Russland männlich ist.
In der Kommunalpolitik werden Frauen zwar zunehmend erfolgreicher und sie besetzen zahlreiche Leitungsfunktionen in nicht-staatlichen Organisationen. Allerdings traut die Mehrheit der WählerInnen den Frauen nicht zu, sich in der großen Politik zu behaupten. Im Gegenteil: Der Frauenanteil in politischen Führungspositionen schrumpft stetig.
Seit 1999 sind gerade einmal 34 von 450 Abgeordneten in der Duma Frauen. In der ersten Legislaturperiode nach dem Fall der Sowjetunion waren immerhin noch 13,6 Prozent der Duma-Abgeordneten weiblich, in der zweiten 11,4 Prozent, jetzt beläuft sich die Zahl auf lediglich 7,2 Prozent. Damit belegt Russland den 80. Platz auf der Liste der Länder, in denen Frauen im Parlament vertreten sind - nach Liberia und der Ukraine.
Unter den neun StellvertreterInnen des Duma-Vorsitzenden ist gerade einmal eine Frau, von 29 Ausschussvorsitzenden zwei Frauen: Swetlana Gorjatschewa (Fraktion der Kommunistischen Partei) ist Vorsitzende des Ausschusses für Frauen, Jugend und Familie und Valentina Piwenko (Abgeordnetengruppe Volksdeputat) ist Vorsitzende des Ausschusses für Probleme des russischen Nordens und Fernen Ostens.
Frauenquote ist unerwünscht
Auch die Exekutive brüstet sich nicht gerade mit weiblichem Personal. Die stellvertretende Premierministerin Valentina Matwejenko, zuständig für Soziales und Kultur, ist Russlands einzige Frau in der Regierung.
Die Betonung einer spezifisch weiblichen Politik lehnt die Mehrheit der Russinnen ab. Dies ist vielleicht der Grund, dass bei der vergangenen Duma-Wahl 1999 die Frauenunion Russlands und die Partei der Verteidigung der Frauen lediglich zwei bzw. 0,8 Prozent der Stimmen erreichten. Allerdings orientierten sich diese auch stark an der alten Kommunistischen Partei und setzten sich für einen Militäreinsatz in Tschetschenien ein, den viele Russinnen ablehnen.
Einzelne Frauenorganisationen und Politikerinnen haben in den vergangenen Monaten immer wieder das Thema Quote auf die politische Tagesordnung gesetzt. In der Bevölkerung stößt diese Idee bei den Frauen jedoch auf wenig Gegenliebe: Nur ein Viertel der Frauen spricht sich für die Quote aus.
Dabei hatte es zu Zeiten der Sowjetrepublik eine Geschlechterquote im Parlament gegeben: Eine Quote von 33 Prozent Frauen wurde von den Komitees der KpdSU im Obersten Sowjet festgelegt, darüber hinaus wurde bestimmt, wie viele Vertreterinnen der Arbeiterklasse oder Akademikerinnen entsandt wurden. Doch dieser Anteil sagte nichts über den tatsächlichen Einfluss von Frauen aus. Führungspositionen besetzte kaum eine Frau, im Parlament waren sie häufig nur für kurze Zeit vertreten und konnten sich daher nicht so gut etablieren wie ihre männlichen Parteigenossen. Das hat sich auch im demokratischen System nicht verändert.
Bis heute sind die Parteien in Russland in männlicher Hand: Lediglich zwei Prozent der Mitglieder politischer Parteien sind Frauen.
Trotzdem hat sich in den Jahren der Transformation ein weibliches Gegengewicht gebildet, dass für eine gleichberechtigte Teilhabe an der Demokratie streiten will. Konkrete Lebensgeschichten zeigen das Leben in dem größten Land der Erde, wie es unterschiedlicher kaum sein könnte. Von der russischen Frau zu sprechen scheint gerade zu unmöglich. Der zwd hat sich anlässlich der Frankfurter Buchmesse in einer Spezialausgabe „Frauen in Russland“ auf weibliche Spurensuche begeben in einem Land zwischen Aufbruch und Stagnation.
Bestellen Sie hier die 24-seitige Spezialausgabe „Frauen in Russland“ zum Preis von 5 Euro.