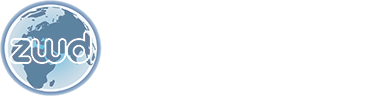20 Jahre ist es her, dass das Binnen-I zur geschlechtergerechten Benennung in der Schweiz ersonnen wurde. Als die Tageszeitung taz 1986 die LeserInnen erstmals mit dem großen I konfrontierte, galt das von einem Mann ein-gebrachte Wagnis als kleine Revolution. Journalistinnenbund (jb) und Friedrich-Ebert-Stiftung haben am 20. Januar in Berlin in ihrem gemeinsamen Gender-Training „Sprachmächtig - 20 Jahre nach dem Binnen-I“ Bilanz gezogen. Rund 70 Frauen und drei Männer diskutierten verschiedene Ansätze für eine nicht-sexistische Sprache.
Als taz-Gründungsmitglied und langjährige taz-Redakteurin habe ich den langen Marsch des großen I durch die Institutionen mitverfolgt, bei dem es sich immer mehr verbog und kleiner und kleiner wurde. Man glaubt es nicht, aber es stimmt: Das große I ist von Männern eingeführt und von Frauen gekillt worden.
Zum ersten Mal tauchte es 1981 in einem Buch über freie Radios auf, wo allemal nur noch von „HörerInnen“ zu lesen war. Der Autor Christoph Busch, der heute in Hamburg Drehbücher verfasst, beschrieb seine Erfindung damals als „Geschlechtsreifung des `i´ und sein Auswachsen zum `I´ infolge häufigen Kontakts zum langen `Schrägstrich´“, womit er die damals allgültige Sprachvariante „Hörer/innen“ meinte. Honi soit qui mal y pense – der phallische Unterton ist nicht zu überhören. Aus diesem deutschen Buch wanderte das große I in die Schweiz aus, in ein Flugblatt des Züricher freien Radios LoRa, das ab Herbst 1983 sendete. Ab 1984 übernahm es die Züricher Wochenzeitung WoZ, die es bis heute recht konsequent anwendet. Von der Schweiz wanderte es wieder zurück nach Deutschland: Der damalige taz-Redakteur Oliver Tolmein guckte es von der WoZ ab und führte es in der taz ein. Die Redaktion nahm es dankbar auf. Bis dato schrieb dort vor allem die Frauenredaktion über „Bürger/innen“ und „Politiker/innen“.
Ich persönlich habe die Schrägstriche nie verwendet, ich sehe sie als Hackebeil-Methode, die die Sprache schlimmer zurichtet als der Metzger das Schnitzel. Die Schrägstrich-Methode wird an Hässlichkeit und Plumpheit nur noch von der Klammer-Methode übertroffen. „Bürger(innen)“ – wenn man das weibliche Geschlecht in Klammer setzt und damit seine Minderwertigkeit zur Schau stellt, kann man es eigentlich gleich bleiben lassen. Genauso grauenerregend sind in der feministischen Szene kursierende Wörter wie „Mitgliederinnen“, „Abgeordnetinnen“ oder „Opferinnen“, sie treiben mir Pickel auf die Stirn. Doof finde ich auch „Lesbierinnen“ – seit wann gibts Lesbier?
Das große I gehörte gar bald zum guten Ton oder zur guten Sprache auch männlicher taz-Redakteure. Von der taz aus trat es seinen Siegeszug durch die Presselandschaft und die Institutionen an. Allerdings vor allem durch die alternative Presse. Meiner Erinnerung nach hat es der „Spiegel“ nur ein einziges Mal verwendet, was wir damals groß feierten.
In der taz haben die Männer die I-Frage letztlich ausgesessen. Es herrschte immer Konsens, dass jede und jeder so schreiben darf, wie es ihr oder ihm gefällt, dass also keine Generalsekretärin von oben das große I vorschreiben darf. Das führte dazu, dass die Frauen mehrheitlich das I verwendeten, während viele Männer stur im alten Stil weiterschrieben. Redaktion und Korrektur redigierten anfangs das I hinein, inzwischen redigieren sie es wieder hinaus. Heute wenden die Frauen in der taz das I nicht mehr an, um nicht als „Feministinnen“ zu gelten, und die überzeugten Feministinnen in der taz gebrauchen es nicht mehr, um nicht als „altbacken“ zu gelten.
Den letzten mir bekannten Aufstand dagegen führte wiederum ein Mann an: Christian Rath. Er beschwerte sich in einem Artikel vom März 1998 über das Verschwinden des I und untersuchte eine, wie er schrieb, „beliebige“ taz-Ausgabe. Ergebnis: Alle Artikel zusammengenommen, fand er einen I-Anteil von unter zehn Prozent, von 41 Texten waren ganze drei geschlechtsneutral verfasst. Es wurde über 27 Männer und 4 Frauen herausgehoben berichtet, was ein Verhältnis 7:1 ergibt. Das ist nun nicht unbedingt die Schuld der taz, weil es einfach die männliche Dominanz in Politik, Wirtschaft und Kultur widerspiegelt. Aber erstaunlicherweise fand Rath in der Ausgabe der Badischen Zeitung vom selben Tag ein Verhältnis von 2:1. Raths Schlussfolgerung: „Wenn die taz sich wieder als betont frauenbewusste Zeitung positionieren will, muss also einiges passieren.“
Ich habe jetzt noch einmal eine ebenso beliebige taz-Ausgabe untersucht, die Wochenendausgabe vom 11.1.2003. Ergebnis: Kein I mehr, nirgends! Eine explizite Feministin schrieb über „Lottomillionärinnen und –millionäre“, das war die einzige frauenfreundliche Sprachwendung. Es wurde über 15 Männer und null Frauen herausgehoben berichtet: über 1 Kanzler, 1 Obdachlosen, 3 Präsidenten, 1 Terroristen, 1 Provokünstler, 1 Arbeiterführer, 1 Angeklagten, 1 Liedermacher, 1 Philosophen, 1 genialen Talkmeister, 1 Schriftsteller, 1 Abgeordneten, 1 Vater der Nation. 1 Existenzgründer (so die Überschrift, Zwischenzeile „Ein-Mann-Betrieb“) stellte sich im Text als Frau heraus. 2 Frauenprojekte wurden vorgestellt, ausgerechnet zum Thema „Geschlechtergerechtigkeit“.
Dafür ist das große I inzwischen in vielen Institutionen und Behörden schon fast selbstverständlich geworden, selbst in Werbeslogans wurde es schon gesichtet. Es war wiederum ein Mann, der es zum ersten Mal „verstaatlicht“ hat: der Berliner Innensenator Erich Pätzold. Auf Anregung der grünen Frauensenatorin Anne Klein ordnete er es in der ersten rot-grünen Koalition Berlins im Juli 1989 für den gesamten Dienstverkehr an. Der Protest, der sich darob im Berliner Abgeordnetenhaus erhob, wurde umgekehrt von einer Frau angeführt: Die CDU-Politikerin Hanna-Renata Laurien fragte den Senat in einer Kleinen Anfrage, ob „für die Normierung der deutschen Rechtschreibung nicht mehr die Duden-Redaktion und der Konsens der Landesregierungen mit der Bundesregierung, vielmehr die Anhängerschaft der AL maßgebend sein soll.“
Der Staat widerspiegelt gewissermaßen den Stand der Geschlechterkämpfe. Inzwischen sichert der staatlich verordnete frauenfreundliche Sprachgebrauch kurioserweise ein Mindestmaß an Geschlechtergerechtigkeit gegen den herrschenden Antifeminismus in der Gesellschaft ab. Die Stellenanzeigen von Behörden oder Universitäten werden stets brav für „AmtsleiterInnen“ oder „Professor/innen“ ausgeschrieben. Nicht immer mit dem großen I, aber fast immer mit weiblicher Endung. Das Bundesministerium für „Frauen und Gedöns“ (Schröder) schreibt inzwischen in seinem „Gleichstellungsgesetz“ vor, Stellen sozusagen paarweise auszuschreiben, also für „einen Professor bzw. eine Professorin“. Gleichstellung – an dieses grauenhafte Wort werde ich mich nie gewöhnen, eine Mischung aus Weichenstellung und Gleichschaltung.
Auch im Berliner Ableger der „Gesellschaft für deutsche Sprache“, im „Redaktionsstab beim Deutschen Bundestag“, wird nach wie vor „eine Menge Anfragen“ verzeichnet. Der Redaktionsstab hat die offizielle Aufgabe, zu prüfen, ob Gesetze verständlich und geschlechtergerecht formuliert sind. In Thüringen ist kaum etwas geschlechtsneutral abgefasst, kann Sprachhüter Michael Solf berichten, während es in saarländischen Gesetz/innen von Schrägstrichen nur so wimmelt. Faustregel also: Je CDU, desto Mann. Je rotgrüner, desto Frau.
Ich persönlich halte das große I für die zweitbeste aller frauenfreundlichen Lösungen. In Wörter wie „InnenministerInnen“ oder „InnenarchitektInnen“ kann ich mich geradezu verlieben, sie sind so wunderbar symmetrisch. Aber was ist mit „PolInnen“? Sorry, das Wort ist einfach nicht lesbar.
Es gibt noch mehr Probleme damit:
· Das große I wirkt sperrig. Vor allem, wenn so grauenhafte Ableitungen wie „LeserInnenbriefe“ oder „LehrerInnengehalt“ benutzt werden. Hier vergeschlechtigen wir überflüssigerweise Sachen und Dinge.
· Das große I markiert einen Text mit der Warninschrift: Vorsicht! Von Feministin geschrieben! Schnell überblättern!
· Das große I eröffnet bösartige Recherchefallen: Wenn ein islamisches Gericht eine Ehebrecherin verurteilt und ich darüber berichten soll, schreibe ich dann RichterInnen oder Richter? Wie soll ich auf Basis einer Agenturmeldung in der halben Stunde vor Redaktionsschluss herausbekommen, ob dabei auch eine Richterin beteiligt war?
· Das große I verführt zu inkonsequenter ideologischer Anwendung. „Mörder“, „Täter“, „Verbrecher“ und „Aggressoren“ gibt es fast nie mit großem I. Oder hat schon mal jemand den Spruch „SoldatInnen sind MörderInnen“ gelesen?
Für den Radio- und TV-Journalismus war das unsprechbare große I sowieso nie eine Alternative. Und mit Paarbildungen, mit Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfegern, Lastwagenfahrlehrinnen und Lastwagenfahrlehrern kann weder man noch frau noch man/frau Karriere machen. Zumal es Vorgesetzte gibt, die lustvoll alle weiblichen Endungen herausstreichen.
Um aus all diesen Dilemmata herauszukommen, hat die feministische Linguistin Luise Pusch 1984 das geschlechtsneutrale Neutrum vorgeschlagen: „das Student“ statt „der Student“. Später befürwortete sie die radikale Feminisierung: also „Bundeskanzlerin Helmut Kohl“. FDP-Ratsfrau Jürgen Kemp in Buchholz in der Nordheide übernahm das 1994 und ließ alle amtlichen Schriftstückinnen in weiblicher Form abfassen. Die Buchholzer Revolutionin dauerte ganze zwei Jahrinnen - bis zur nächsten Wahlin.
Man sieht: Wenn man aus einem Dilemma herauskommen will, gerät man in das nächste. Deshalb gibt es auch kein Patentrezept für frauenfreundliche Sprache, was immer gilt und für alle Zeiten überzeugend wirkt.
Ich persönlich halte elegante geschlechtsneutrale Umschreibungen für die beste aller vorläufigen Lösungen. Auch die „Gesellschaft für deutsche Sprache“ rät bei der Beackerung des Sprachfeldes von schwerem Gerät wie dem großen I ab und empfiehlt statt dessen geschickte Umschreibungen und neutrale Formen. Es gibt mehr als man denkt! Ich habe beispielsweise das Wort „keiner“ aus meinem Wortschatz gestrichen. Aus: „Keiner von den Dozenten, die zum Arzt gingen, war wirklich krank“ wird in konsequent geschlechtsneutralem Jargon: „Niemand von den Lehrkräften, die sich ein ärztliches Attest besorgten, war wirklich krank.“ Auch Wendungen wie „jeder, der“ sind vermeidbar. Aus: „Jeder, der einen Pass haben will, muss diesen fünf Jahre vorher beantragen...“ wird: „Wer einen Pass beantragt, muss...“
Anders als die „Gesellschaft für deutsche Sprache“ beharre ich aber darauf, dass wir auch das große I weiterhin verwenden sollten, je nach Thema und Publikum. Nicht in allen Bereichen gibt es geschlechtsneutrale Formulierungen wie „Studierende“ oder „Personalkräfte“. Und uns muss es ja auch weiterhin darum gehen, die Frauen sichtbar zu machen.
Deshalb bin ich für kreative Lösungen, für Sprachwitz, Ironie, weibliche List, Störmanöver, Irritationen. Die Zeit der Großideologien ist vorbei, die Zeit der feministischen Großstrategien womöglich auch. Jetzt gehts darum, im Versteck auszuharren, aus dem Hinterhalt zuzuschlagen, mit immer neuen Taktiken. Ich plädiere für Sprachguerilla – in Erinnerung an die „Guerilla-Grrrls“ in New York, die mit ihren witzigen und subversiven Aktionen die Kulturszene aufgemischt haben. Vielleicht sollten wir uns zu gemeinsamen Sprachguerilla-Manövern verabreden. Vielleicht sollten wir am 8. März in so vielen Medien wie möglich gemeinsam die weibliche Endung verwenden und konsequent von Politikerinnen und Wirtschaftsführerinnen reden.
Ute Scheub
Als taz-Gründungsmitglied und langjährige taz-Redakteurin habe ich den langen Marsch des großen I durch die Institutionen mitverfolgt, bei dem es sich immer mehr verbog und kleiner und kleiner wurde. Man glaubt es nicht, aber es stimmt: Das große I ist von Männern eingeführt und von Frauen gekillt worden.
Zum ersten Mal tauchte es 1981 in einem Buch über freie Radios auf, wo allemal nur noch von „HörerInnen“ zu lesen war. Der Autor Christoph Busch, der heute in Hamburg Drehbücher verfasst, beschrieb seine Erfindung damals als „Geschlechtsreifung des `i´ und sein Auswachsen zum `I´ infolge häufigen Kontakts zum langen `Schrägstrich´“, womit er die damals allgültige Sprachvariante „Hörer/innen“ meinte. Honi soit qui mal y pense – der phallische Unterton ist nicht zu überhören. Aus diesem deutschen Buch wanderte das große I in die Schweiz aus, in ein Flugblatt des Züricher freien Radios LoRa, das ab Herbst 1983 sendete. Ab 1984 übernahm es die Züricher Wochenzeitung WoZ, die es bis heute recht konsequent anwendet. Von der Schweiz wanderte es wieder zurück nach Deutschland: Der damalige taz-Redakteur Oliver Tolmein guckte es von der WoZ ab und führte es in der taz ein. Die Redaktion nahm es dankbar auf. Bis dato schrieb dort vor allem die Frauenredaktion über „Bürger/innen“ und „Politiker/innen“.
Ich persönlich habe die Schrägstriche nie verwendet, ich sehe sie als Hackebeil-Methode, die die Sprache schlimmer zurichtet als der Metzger das Schnitzel. Die Schrägstrich-Methode wird an Hässlichkeit und Plumpheit nur noch von der Klammer-Methode übertroffen. „Bürger(innen)“ – wenn man das weibliche Geschlecht in Klammer setzt und damit seine Minderwertigkeit zur Schau stellt, kann man es eigentlich gleich bleiben lassen. Genauso grauenerregend sind in der feministischen Szene kursierende Wörter wie „Mitgliederinnen“, „Abgeordnetinnen“ oder „Opferinnen“, sie treiben mir Pickel auf die Stirn. Doof finde ich auch „Lesbierinnen“ – seit wann gibts Lesbier?
Das große I gehörte gar bald zum guten Ton oder zur guten Sprache auch männlicher taz-Redakteure. Von der taz aus trat es seinen Siegeszug durch die Presselandschaft und die Institutionen an. Allerdings vor allem durch die alternative Presse. Meiner Erinnerung nach hat es der „Spiegel“ nur ein einziges Mal verwendet, was wir damals groß feierten.
In der taz haben die Männer die I-Frage letztlich ausgesessen. Es herrschte immer Konsens, dass jede und jeder so schreiben darf, wie es ihr oder ihm gefällt, dass also keine Generalsekretärin von oben das große I vorschreiben darf. Das führte dazu, dass die Frauen mehrheitlich das I verwendeten, während viele Männer stur im alten Stil weiterschrieben. Redaktion und Korrektur redigierten anfangs das I hinein, inzwischen redigieren sie es wieder hinaus. Heute wenden die Frauen in der taz das I nicht mehr an, um nicht als „Feministinnen“ zu gelten, und die überzeugten Feministinnen in der taz gebrauchen es nicht mehr, um nicht als „altbacken“ zu gelten.
Den letzten mir bekannten Aufstand dagegen führte wiederum ein Mann an: Christian Rath. Er beschwerte sich in einem Artikel vom März 1998 über das Verschwinden des I und untersuchte eine, wie er schrieb, „beliebige“ taz-Ausgabe. Ergebnis: Alle Artikel zusammengenommen, fand er einen I-Anteil von unter zehn Prozent, von 41 Texten waren ganze drei geschlechtsneutral verfasst. Es wurde über 27 Männer und 4 Frauen herausgehoben berichtet, was ein Verhältnis 7:1 ergibt. Das ist nun nicht unbedingt die Schuld der taz, weil es einfach die männliche Dominanz in Politik, Wirtschaft und Kultur widerspiegelt. Aber erstaunlicherweise fand Rath in der Ausgabe der Badischen Zeitung vom selben Tag ein Verhältnis von 2:1. Raths Schlussfolgerung: „Wenn die taz sich wieder als betont frauenbewusste Zeitung positionieren will, muss also einiges passieren.“
Ich habe jetzt noch einmal eine ebenso beliebige taz-Ausgabe untersucht, die Wochenendausgabe vom 11.1.2003. Ergebnis: Kein I mehr, nirgends! Eine explizite Feministin schrieb über „Lottomillionärinnen und –millionäre“, das war die einzige frauenfreundliche Sprachwendung. Es wurde über 15 Männer und null Frauen herausgehoben berichtet: über 1 Kanzler, 1 Obdachlosen, 3 Präsidenten, 1 Terroristen, 1 Provokünstler, 1 Arbeiterführer, 1 Angeklagten, 1 Liedermacher, 1 Philosophen, 1 genialen Talkmeister, 1 Schriftsteller, 1 Abgeordneten, 1 Vater der Nation. 1 Existenzgründer (so die Überschrift, Zwischenzeile „Ein-Mann-Betrieb“) stellte sich im Text als Frau heraus. 2 Frauenprojekte wurden vorgestellt, ausgerechnet zum Thema „Geschlechtergerechtigkeit“.
Dafür ist das große I inzwischen in vielen Institutionen und Behörden schon fast selbstverständlich geworden, selbst in Werbeslogans wurde es schon gesichtet. Es war wiederum ein Mann, der es zum ersten Mal „verstaatlicht“ hat: der Berliner Innensenator Erich Pätzold. Auf Anregung der grünen Frauensenatorin Anne Klein ordnete er es in der ersten rot-grünen Koalition Berlins im Juli 1989 für den gesamten Dienstverkehr an. Der Protest, der sich darob im Berliner Abgeordnetenhaus erhob, wurde umgekehrt von einer Frau angeführt: Die CDU-Politikerin Hanna-Renata Laurien fragte den Senat in einer Kleinen Anfrage, ob „für die Normierung der deutschen Rechtschreibung nicht mehr die Duden-Redaktion und der Konsens der Landesregierungen mit der Bundesregierung, vielmehr die Anhängerschaft der AL maßgebend sein soll.“
Der Staat widerspiegelt gewissermaßen den Stand der Geschlechterkämpfe. Inzwischen sichert der staatlich verordnete frauenfreundliche Sprachgebrauch kurioserweise ein Mindestmaß an Geschlechtergerechtigkeit gegen den herrschenden Antifeminismus in der Gesellschaft ab. Die Stellenanzeigen von Behörden oder Universitäten werden stets brav für „AmtsleiterInnen“ oder „Professor/innen“ ausgeschrieben. Nicht immer mit dem großen I, aber fast immer mit weiblicher Endung. Das Bundesministerium für „Frauen und Gedöns“ (Schröder) schreibt inzwischen in seinem „Gleichstellungsgesetz“ vor, Stellen sozusagen paarweise auszuschreiben, also für „einen Professor bzw. eine Professorin“. Gleichstellung – an dieses grauenhafte Wort werde ich mich nie gewöhnen, eine Mischung aus Weichenstellung und Gleichschaltung.
Auch im Berliner Ableger der „Gesellschaft für deutsche Sprache“, im „Redaktionsstab beim Deutschen Bundestag“, wird nach wie vor „eine Menge Anfragen“ verzeichnet. Der Redaktionsstab hat die offizielle Aufgabe, zu prüfen, ob Gesetze verständlich und geschlechtergerecht formuliert sind. In Thüringen ist kaum etwas geschlechtsneutral abgefasst, kann Sprachhüter Michael Solf berichten, während es in saarländischen Gesetz/innen von Schrägstrichen nur so wimmelt. Faustregel also: Je CDU, desto Mann. Je rotgrüner, desto Frau.
Ich persönlich halte das große I für die zweitbeste aller frauenfreundlichen Lösungen. In Wörter wie „InnenministerInnen“ oder „InnenarchitektInnen“ kann ich mich geradezu verlieben, sie sind so wunderbar symmetrisch. Aber was ist mit „PolInnen“? Sorry, das Wort ist einfach nicht lesbar.
Es gibt noch mehr Probleme damit:
· Das große I wirkt sperrig. Vor allem, wenn so grauenhafte Ableitungen wie „LeserInnenbriefe“ oder „LehrerInnengehalt“ benutzt werden. Hier vergeschlechtigen wir überflüssigerweise Sachen und Dinge.
· Das große I markiert einen Text mit der Warninschrift: Vorsicht! Von Feministin geschrieben! Schnell überblättern!
· Das große I eröffnet bösartige Recherchefallen: Wenn ein islamisches Gericht eine Ehebrecherin verurteilt und ich darüber berichten soll, schreibe ich dann RichterInnen oder Richter? Wie soll ich auf Basis einer Agenturmeldung in der halben Stunde vor Redaktionsschluss herausbekommen, ob dabei auch eine Richterin beteiligt war?
· Das große I verführt zu inkonsequenter ideologischer Anwendung. „Mörder“, „Täter“, „Verbrecher“ und „Aggressoren“ gibt es fast nie mit großem I. Oder hat schon mal jemand den Spruch „SoldatInnen sind MörderInnen“ gelesen?
Für den Radio- und TV-Journalismus war das unsprechbare große I sowieso nie eine Alternative. Und mit Paarbildungen, mit Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfegern, Lastwagenfahrlehrinnen und Lastwagenfahrlehrern kann weder man noch frau noch man/frau Karriere machen. Zumal es Vorgesetzte gibt, die lustvoll alle weiblichen Endungen herausstreichen.
Um aus all diesen Dilemmata herauszukommen, hat die feministische Linguistin Luise Pusch 1984 das geschlechtsneutrale Neutrum vorgeschlagen: „das Student“ statt „der Student“. Später befürwortete sie die radikale Feminisierung: also „Bundeskanzlerin Helmut Kohl“. FDP-Ratsfrau Jürgen Kemp in Buchholz in der Nordheide übernahm das 1994 und ließ alle amtlichen Schriftstückinnen in weiblicher Form abfassen. Die Buchholzer Revolutionin dauerte ganze zwei Jahrinnen - bis zur nächsten Wahlin.
Man sieht: Wenn man aus einem Dilemma herauskommen will, gerät man in das nächste. Deshalb gibt es auch kein Patentrezept für frauenfreundliche Sprache, was immer gilt und für alle Zeiten überzeugend wirkt.
Ich persönlich halte elegante geschlechtsneutrale Umschreibungen für die beste aller vorläufigen Lösungen. Auch die „Gesellschaft für deutsche Sprache“ rät bei der Beackerung des Sprachfeldes von schwerem Gerät wie dem großen I ab und empfiehlt statt dessen geschickte Umschreibungen und neutrale Formen. Es gibt mehr als man denkt! Ich habe beispielsweise das Wort „keiner“ aus meinem Wortschatz gestrichen. Aus: „Keiner von den Dozenten, die zum Arzt gingen, war wirklich krank“ wird in konsequent geschlechtsneutralem Jargon: „Niemand von den Lehrkräften, die sich ein ärztliches Attest besorgten, war wirklich krank.“ Auch Wendungen wie „jeder, der“ sind vermeidbar. Aus: „Jeder, der einen Pass haben will, muss diesen fünf Jahre vorher beantragen...“ wird: „Wer einen Pass beantragt, muss...“
Anders als die „Gesellschaft für deutsche Sprache“ beharre ich aber darauf, dass wir auch das große I weiterhin verwenden sollten, je nach Thema und Publikum. Nicht in allen Bereichen gibt es geschlechtsneutrale Formulierungen wie „Studierende“ oder „Personalkräfte“. Und uns muss es ja auch weiterhin darum gehen, die Frauen sichtbar zu machen.
Deshalb bin ich für kreative Lösungen, für Sprachwitz, Ironie, weibliche List, Störmanöver, Irritationen. Die Zeit der Großideologien ist vorbei, die Zeit der feministischen Großstrategien womöglich auch. Jetzt gehts darum, im Versteck auszuharren, aus dem Hinterhalt zuzuschlagen, mit immer neuen Taktiken. Ich plädiere für Sprachguerilla – in Erinnerung an die „Guerilla-Grrrls“ in New York, die mit ihren witzigen und subversiven Aktionen die Kulturszene aufgemischt haben. Vielleicht sollten wir uns zu gemeinsamen Sprachguerilla-Manövern verabreden. Vielleicht sollten wir am 8. März in so vielen Medien wie möglich gemeinsam die weibliche Endung verwenden und konsequent von Politikerinnen und Wirtschaftsführerinnen reden.
Ute Scheub