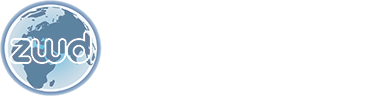Ein Beben erschütterte die bildungspolitische in Deutschland am 4. Dezember 2001, der Tag an dem Berlin die Ergebnisse der PISA-Studie vorgestellt wurden. Es folgten Flutwellen der Betroffenheit und des Reformeifers, denn: Deutschland nimmt in dem internationalen Leistungsvergleich nur einen Platz im hinteren Drittel ein. Mitten in den Bundestagswahlkampf fiel am 27. Juni die Veröffentlichung der nationalen Ergänzungsstudie PISA-E, die die Leistungen der SchülerInnen nach Bundesländern differenziert. Kritikern des bundesdeutschen Bildungsföderalismus brachte das unterschiedliche Abschneiden der Jugendlichen unerwarteten Aufwind.
Was aber genau ist PISA, und rechtfertigt ein einziges wissenschaftliches Papier die Infragestellung eines ganzen Bildungssystems von der Struktur über Rahmenlehrpläne bis hin zur LehrerInnenausbildung? Für einen umfassenden Überblick hat der zwd Informationen zur OECD-Studie – Beiträge des zwd Bildung Wissenschaft Kulturpolitik sowie Dokumenten- und Linksammlung - zusammengestellt und in einem Themendienst „PISA“ gebündelt.
PISA und PISA-E
Der Name PISA ist Abkürzung für „Programme for International Student Assessment“. An der bislang weltweit größten Bildungsstudie, die von der „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (OECD) in Paris durchgeführt wird, beteiligten sich im Jahr 2000 rund 265.000 Schüler aus 32 Staaten am ersten Projektzyklus. Deutschland beteiligt sich an dem Forschungsprogramm auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Forschung und der Kultusministerkonferenz (KMK). Zurückzuführen ist PISA auf eine Selbstverpflichtung der OECD-Staaten mit dem Ziel, sich durch Messung von Schülleistung auf der Grundlage einer gemeinsamen internationalen Rahmenkonzeption ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme zu machen. Alle drei Jahre soll die Studie die Fähigkeiten von 15jährigen Schülerinnen und Schülern nicht nur in den Bildungsbereichen Leseverständnis, Mathematik und Naturwissenschaften sondern auch fächerübergreifende Problemlösungskompetenzen erfassen: Wie weit sind die Jugendlichen in der Lage, die erworbenen Kenntnisse auch tatsächlich auf alltägliche Aufgaben anzuwenden? Ausgewertet werden die Untersuchungs-Ergebnisse unter der Berücksichtigung der sozialen Lern- und Lebensbedingungen der Jugendlichen in den einzelnen Teilnehmerstaaten.
Ziel ist also, vergleichbare Daten über die Ressourcenausstattung und deren individuelle Nutzung sowie über die Funktions- und Leistungsfähigkeit verschiedener Bildungssysteme zu liefern. Über die Beschreibung des Ist-Zustandes hinaus will PISA auch Veränderungen in Bildungssystemen sowie deren Folgen aufzeigen und damit Ansatzpunkte für Verbesserungen in Schulen liefern. Die Untersuchung ist daher konzeptionell in drei Projektzyklen bis zum Jahr 2006 angelegt. Der erste Zyklus (PISA 2000) hat insbesondere den Bereich Lesen in den Mittelpunkt gerückt. Mathematik und Naturwissenschaften bildeten lediglich Nebenkomponenten, auf die erst bei PISA 2003 beziehungsweise PISA 2006 fokussiert wird. Methodisch ist der Test eine Mischung: Der Fragebogen, den die Schüler in etwa 20 bis 30 Minuten auszufüllen hatten, enthält sowohl „Multiple Choice“-Aufgaben als auch Fragen, auf die ausformulierte Antworten verlangt wurden. Zudem wurden die Schulleiter um Auskünfte zu ihrer Schule gebeten.
Entwickelt wurde die Rahmenkonzeption des Tests, der alle Teilnehmerländer zustimmen mussten, durch eine internationale Expertengruppe unter Leitung von Raymond Adams vom Australian Council for Education Research. Weiterhin waren für das Design und die Implementierung der Erhebung folgende Forschungseinrichtungen zuständig: Netherlands National Institute for Eductional Measurement, Educational Testing Service (USA), National Institute for Educational Research (Japan) und WESTAT (USA).
Der internationale Leistungsvergleich wird erweitert durch nationale Ergänzungsstudien, die in allen teilnehmenden Staaten durchgeführt wurden und sich an den jeweiligen Lehrplänen orientieren.
Die Ergebnisse im einzelnen:
Lesekompetenz:
Die Fähigkeit einfache bis komplexe Texte zu verstehen, vom Herausfinden einer simplen Information oder der Identifizierung des jeweiligen Hauptthemas bis hin zur Informationsbewertung, Hypothesenbildung und der Anwendung spezieller Kenntnisse, ist in einer Kompetenzskala von 1 bis 5 differenziert. Die Stufe 1 bildet hier das niedrigste, die Stufe 5 das höchste Niveau ab. In einem zusammenfassenden Ranking nimmt Deutschland den Platz 21 ein und liegt damit „signifikant“, wie es im Forschungsbericht heißt, unter dem OECD-Durchschnitt und sechs Plätze beispielsweise hinter dem oft gescholtenen Bildungssystem der Vereinigten Staaten.
In der höchsten Kompetenzstufe (5), die für erstklassige Lesekompetenz steht, sind im OECD-Mittel zehn Prozent der Schüler einzuordnen. In Deutschland sind es nur neun, Spitzenreiter Finnland hat mit 18 Prozent einen doppelt so hohen Anteil an Schülern mit herausragenden Lesefähigkeiten. Besorgniserregender noch ist aber die Betrachtung der unteren Skala: Durchschnittlich waren in den Teilnehmerländern sechs Prozent der 15Jährigen noch unter dem Leistungsniveau 1, der niedrigsten Kompetenzstufe. In Deutschland sind es ganze zehn Prozent. Zählt man die Schüler, die noch die Stufe 1 erreicht haben ( 13 %), dazu, heißt das für die Bewertung der deutschen Bildungseinrichtungen: Jeder vierte Jugendliche kurz vor dem Ende seiner Pflichtschulzeit kann elementares Textverständnis nur bedingt oder gar nicht aufweisen. In Finnland weisen eine solche Leistungsschwäche nur sieben, in Kanada neun Prozent der Schüler auf.
Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenz:
Sowohl in der mathematischen als auch in der naturwissenschaftlichen Grundbildung, die in diesem ersten Untersuchungszyklus nur eine untergeordnete Rolle einnehmen, liegt Deutschland jeweils mit Platz 20 ebenfalls unterhalb des OECD-Leistungsdurchschnitts und im letzten Drittel des Ländervergleichs. Führend in der mathematischen Kompetenz sind Japan, gefolgt von Korea, die mit getauschter Rangfolge auch die Naturwissenschaften dominieren. Auch Finnland ist mit Platz vier und drei wieder stark vertreten. Detaillierte Vergleichsuntersuchungen zu diesen beiden Bereichen werden aber erst in den Jahren 2003 und 2006 erfolgen.
Insgesamt zeigten die Ergebnisse, dass eine hohe Gesamtleistung meist mit einer gleichmäßigen Verteilung der Ergebnisse einhergeht. So weisen etwa Länder wie Finnland, Japan und Korea ein vergleichsweise geringes Leistungsgefälle zwischen den besten und den schwächsten Schülern auf – bei einem hohen Durchschnittsniveau. Deutschland hingegen ist nach Meinung der OECD-Forscher eines der Länder mit dem größten Abstand zwischen den Besten und den Schwächsten und bleibt auch in der Gesamtleistung unter dem Länderdurchschnitt. Erklärt wird der größte Teil dieser Abweichung mit der Differenzierung des deutschen Schulsystems: „In Ländern“, so die Analyse der Studie, „die einem frühen Alter zwischen Schultypen differenzieren, scheinen die Unterschiede bei den Schülerleistungen und die Leistungsunterschiede zwischen den Schulen größer zu sein.“ Gemeinsam ist allen Ländern, dass Mädchen im Durchschnitt bei der Lesekompetenz besser sind als Jungen, während diese in der mathematischen Grundbildung ihren Mitschülerinnen voraus sind.
Bemerkenswert am Rande: Eines der an der Studie teilnehmenden Länder kann sich entspannt zurücklehnen und die Aufregung andernorts belächeln. Obwohl ein Niederländisches Institut in die Testentwicklung eingebunden worden war, findet sich das kleine Land an der Nordsee in der Statistik nur auf einem Sonderplatz: Die Qualität der Schülerleistung lasse sich mit den erarbeiteten Kriterien kaum erfassen, weil das niederländische Bildungssystem erheblich von allen anderen abweiche, so die Begründung der Forscher.
Aufgeregter waren zunächst die Reaktionen in Deutschland. Nach dem ersten Schock und den sich anschließenden Rufen nach schnellen Reformen im deutschen Bildungswesen bis hin zum Aufbruch der föderalen Struktur mahnen aber inzwischen Kritiker auch zur Zurückhaltung. So betonte etwa die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) Prof. Dr. Dagmar Schipanski die „Schlüsselrolle“ von Qualität bei der Ausbildung und Bildung vor dem Hintergrund einer sich wandelnde Gesellschaft. „Patentlösungen gibt es aber angesichts der Komplexität der Materie nicht, so Schipanski. Im zweiwochendienst warnt Prof. Dr. Rolf Wernstedt, Landtagspräsident in Niedersachsen und ehemals Kultusminister, vor bildungspolitischen Schnellschüssen. Die PISA-Studie solle zunächst einmal zum Nachdenken anregen. Der Hamburger Erziehungswissenschaftler Peter Struck hält sogar den Forschungsbericht für nicht aussagekräftig, weil die Schulsysteme verschiedener Länder und Kulturkreise nicht miteinander verglichen werden könnten. So sei etwa das gute Abschneiden von Japan und Korea bei den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten auf die dortigen „strengen Paukschulen“ zurückzuführen, die mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar wären.
Dennoch, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch: Die strategische Zielsetzung der EU-Bildungsminister „aber auch die Ergebnisse der PISA-Studie verlangen eine Bildungsoffensive auf nationaler und europäischer Ebene“, sagte am 14. Februar der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesbildungsministerium Wolf-Michael Catenhusen im EU-Bildungsministerrat.
PISA-E
Dass es bei der SchülerInnenleistungen erhebliche Unterschiede auch zwischen den Bundesländern gibt, hat die Ergänzungsstudie PISA-E offenbart, deren Ergebnisse am 27. Juni 2002 veröffentlicht wurden – zur internationalen Spitze konnte kein Bundesland aufschließen. Deutliche regionale Unterschiede innerhalb Deutschlands wurden nicht nur bei der Leistungsfähigkeit der Mädchen und Jungen festgestellt, sondern auch bei den Anteilen der SchülerInnen mit Hochschulreife oder ganz ohne Abschluss sowie bei den Bildungsinvestitionen. So zeigt die nach Bundesländern differenzierende Ergänzungsuntersuchung auch, dass innerhalb Deutschlands keine Chancengleichheit herrscht hinsichtlich der Aufwendungen je SchülerIn, der Anzahl der erteilten Unterrichtsstunden im Schulverlauf und etwa der Auswahl der Abituraufgaben. Ausführlich sind die Ergebnisse im zweiwochendienst Bildung Wissenschaft Kulturpolitik 11-12/02 dokumentiert.
Länderübersicht
Bayern
Als Konsequenz aus den Ergebnissen der PISA-Studie will Bayern „dem Kindergarten eine Bildungsaufgabe geben“ und Sprachförderung vor Schuleintritt sowie in Grund- und Hauptschule einführen. Die LehrerInnenaus- und –fortbildung soll den neuen Anforderungen entsprechend reformiert und - entgegen bisheriger Praxis im südlichen Bundesland – Ganztagsangebote ausgebaut werden. Eine 26-seitige Broschüre des Kultusministeriums (August 2002) informiert zu Ergebnissen und Folgerungen aus dem OECD-Leistungsvergleich. Zudem sind auf fünf Seiten (PISA und die innere Schulentwicklung) Handlungsfelder aus bayerischer Sicht skizziert.
zwd-Online exklusiv:
Lernen in Zeiten nach PISA heißt:
Anderes anders lernen
Die Kultusministerkonferenz sei das „Organisations-Bündel kontroverser Politiken“, meint der Pädagoge Otto Herz. Der Schlüssel zur Überwindung der schlechten PISA-Ergebnisse liege in der Entwicklung einer neuen Qualität der Lernkultur und nicht in einer vielerorts propagierten Verkürzung der Schulzeit. Im Gespräch mit dem zwd erinnert der freiberufliche Erziehungswissenschaftler unter anderem an die in den 70er Jahren von Hartmut von Hentig initiierte und von ihm maßgeblich mitgestaltete Bielefelder Laborschule und plädiert für eine ermutigende auf Vertrauen basierende Lernkutur.
Nationale Schulleistungsstudien - Erkenntnisse und notwendige Konsequenzen.
Die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz seien nicht ausreichend, meint Renate Hendriks. Im ihrem Kommentar zur PISA-E-Studie schreibt die Vorsitzende des Bundeselternrates exklusiv in zwd-Online: „Was fehlt, sind verbindliche Ziel- und Zeitvorgaben.“ Dort wo zeitliche Vorstellungen
geäußert worden seien wie bei der Entwicklung von verbindlichen Standards, seien diese zu langfristig geplant. Die föderale Struktur stehe schnelleren Übereinkünften offenbar im Weg. In ihrem Beitrag zählt die Diplom-Sozialpädagogin bildungspolitisch wichtige Handlungsfelder
auf und nennt Reformvorschläge für eine besseren Schul- und Unterrichtsqualität.
PISA-E - Standards? Zu welchem Ziel?
Die Aufstellung von Leistungsstandards ist nach Meinung von Ingrid Wenzler nicht der „Königsweg zum Erfolg“, wenn es um eine Reform des Bildungswesens geht. „Standards sind kein Ersatz für die Grundfrage, die in Deutschland zu klären ist: Wie ernsthaft gilt der Verfassungsauftrag
der Chancengleichheit im Bildungsbereich“, betont die Bundesvorsitzende der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule (GGG) in ihrem Kommentar zur PISA-E-Studie, den zwd-Online exklusiv veröffentlicht.
PISA 2003, der zweite Zyklus der folgenreichen OECD-Leistungsvergleichsstudie, ist längst aus der Planungsphase getreten. Inzwischen hat das deutsche PISA-Konsortium unter Federführung des Leipniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) in Kiel eine Webseite ins Netz gestellt, um über Fortschritte und Neuerungen der Folge-Studie zu informieren.
zweiwochendienst-Ausgaben zum Thema:
Nr. 15-16/01, Seite 3
Vor der PISA-Veröffentlichung: AfB problematisiert Schulleistungsvergleiche
Nr. 17-18/01, Seiten 2-13, 17-23, 26, 28
Stoiber: Zuwandererkinder verantwortlich für das schlechte Abschneiden der Deutschen; PISA forciert Debatte über föderale Struktur; Bildungsforscher warnen vor schnellen Rezepten; Prof. Dr. Rolf Wernstedt: Eine Aufforderung zum Denken; Eine Studie erschüttert die deutsche Bildungslandschaft (Dokumentation); GGG: Deutschland ist Spitze bei der sozialen Auslese; GEW: 10mal Qualität für bessere Schule; Kultusminister und Lehrerorganisationen einig; PISA II: SchülerInnenbefragungen, nun rücken auch die Eltern ins Kreuzfeuer.
Online-Beilage, Seite II
Zwd-Net-Service: PISA – Ergebnisse, Stellungnahmen, Kommentare, Reformvorschläge.
Nr. 19-20/01, Seite 13
VBE für neuen Bildungsrat
Online-Beilage, Seiten I-III
Blick über´n Zaun: Österreich und Finnland nach den PISA-Ergebnissen.
Nr. 1-2/02, Seite 31
Hans-Peter Bartels: Sozialdemokratische Bildungspolitik - Selbstkritik und Offensive.
Online-Beilage, Seite IV
Blick über´n Zaun: Kanada – Spitzenplatz bei PISA und bei den Bildungsausgaben.
Nr. 4-5/02, Seiten 5, 23, 28
PISA-E und Ganztagsschulen werden Wahlkampfthemen; Bundeskanzler Gerhard Schröder im Wortlaut auf dem Kongress „Mitte in Deutschland“; Kulturföderalismus: Brandenburgs Bildungsminister Steffen Reiche für landerübergreifende Schulstandards.
Nr. 6/02, Seiten 2-5
Bundeseinheitliche Standards für den Schulleistungsvergleich; Interview: Gerd Harms, Kultusminister in Sachsen-Anhalt, für nationale Bildungsberichterstattung
Online-Beilage, Seite VI
Bildungsrat für Niedersachsen
Nr. 7/02, Seiten 4-6
AfB-Bundeskonferenz: Schulstrukturen müssen auf den Prüfstand; NRW: „Das Fundament jeder Bildung“.
Online-Beilage, Seite II
Blick über´n Zaun: Schweden – Einheitsschule mit Erfolg
Nr. 8/02, Seiten 2, 4-5, 12
KMK plant eigenen Bildungsbericht; FDP-Bundesparteitag: Gegen Studiengebühren – für Auflösung der KMK, dazu der Kommentar von Jörg Tauss, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion; Mikrozensus: Bildung in sozialer Schieflage.
Nr. 9-10/02, Seiten 2-7, 20, 22-24
Bund stellt Länderkompetenz in Frage; PISA-E: Ergebnisse auf den ersten und den zweiten Blick; Bildungsetat steigt; Regierungserklärung des Bundeskanzlers: Gerechtigkeit durch Bildung; DGB-Bundeskongress: Gewerkschaftsbund fordert Bildungsreform; Signifikante Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen.
Bildung und Politik Online, Seiten IV-V
Blick über´n Zaun, zwd-Net-Service: Norwegen.
Nr. 11-12/02, Seiten 2-28 (PISA-E-Themenschwerpunkt)
KMK: Leistungsstandards bis 2004; Bundesbildungsministerium für nationale Antwort auf PISA-E; Prof. Dr. Rolf Wernstedt über den ungebildeten Umgang mit PISA; PISA-E: Die Bundesländer im Vergleich (Dokumentation); Interview: Prof. Hans-Günter Rolff „Die Gesamtschule in Deutschland kann nicht leben und nicht sterben“; McKinsey fordert Bildungsreform.
Nr. 13-14/02, Seite 28
5. Bericht zur Lage der AusländerInnen in Deutschland: Bessere Sprach- und Schulförderung.
Nr. 17, Seite 9
Debatte um Deutschlands Teilnahme am "PISA-Lehrertest".
Dokumente zum Thema:
Die Ergebnisse der OECD-Leistungsstudie PISA 2000 (367 Seiten)
PISA 2000: Zusammenfassung zentraler Befunde (51 Seiten)Link funktioniert nicht
Zusammenfassung der PISA-Ergänzungsstudie (PISA-E)
Pressespiegel zu den Reaktionen nach Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse Dezember 2001 bis Januar 2002 (774 Seiten; Zusammenstellung: OECD)
Stellungnahmen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zur PISA-Debatte (Dezember 2001 bis Juli 2002)
Die zwölf Empfehlungen des Forums Bildung
Michael Kanders / Hans-Günter Rolff: Mehr von allem, aber wenig ändern!
Ergebnisse der neuen IFS-Repräsentativbefragung zu Schule und Bildung(April 2002)
Weiterführende Links zum Thema:
OECD-Seite: www.pisa.oecd.org
OECD-Seite mit Links zu den nationalen Berichten: www.pisa.oecd.org/NatReports/cntry.htm
M-P-Institut (PISA Deutschland): www.mpib-berlin.mpg.de/pisa
Zusammenfassung PISA-E: www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/PISA_E_Zusammenfassung2.pdf
NRW-Angebot: http://www.learn-line.nrw.de/angebote/pisa/
Empfehlungen des Forum-Bildung: www.forum-bildung.de/new/html/01_empf/lz_01.html
Zusammenstellung: www.forum-bildung.de/themen/tpl_t117.php3
IPN (PISA 2003 Deutschland): www.ipn.uni-kiel.de/projekte/pisa/index.html
Deutscher Bildungsserver: www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1269
Informationssammlungen zu PISA vom Deutschen Bildungsserver: www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1273
PISA-Hamburg: www.hamburger-bildungsserver.de/schulentwicklung/welcome.phtml?rechts=/schulentwicklung/pisa
Bremen: www.bildung.bremen.de/pisa
NRW: www.mswf.nrw.de/aktuell/PISA-Reaktion.html
GEW: www.gew.de/standpunkt/aschlagzeilen/schule/pisa
PISA-Österreich: www.pisa-austria.at/index.htm
PISA-Schweiz: www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber15/pisa/pisa.htm
Was aber genau ist PISA, und rechtfertigt ein einziges wissenschaftliches Papier die Infragestellung eines ganzen Bildungssystems von der Struktur über Rahmenlehrpläne bis hin zur LehrerInnenausbildung? Für einen umfassenden Überblick hat der zwd Informationen zur OECD-Studie – Beiträge des zwd Bildung Wissenschaft Kulturpolitik sowie Dokumenten- und Linksammlung - zusammengestellt und in einem Themendienst „PISA“ gebündelt.
PISA und PISA-E
Der Name PISA ist Abkürzung für „Programme for International Student Assessment“. An der bislang weltweit größten Bildungsstudie, die von der „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (OECD) in Paris durchgeführt wird, beteiligten sich im Jahr 2000 rund 265.000 Schüler aus 32 Staaten am ersten Projektzyklus. Deutschland beteiligt sich an dem Forschungsprogramm auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Forschung und der Kultusministerkonferenz (KMK). Zurückzuführen ist PISA auf eine Selbstverpflichtung der OECD-Staaten mit dem Ziel, sich durch Messung von Schülleistung auf der Grundlage einer gemeinsamen internationalen Rahmenkonzeption ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme zu machen. Alle drei Jahre soll die Studie die Fähigkeiten von 15jährigen Schülerinnen und Schülern nicht nur in den Bildungsbereichen Leseverständnis, Mathematik und Naturwissenschaften sondern auch fächerübergreifende Problemlösungskompetenzen erfassen: Wie weit sind die Jugendlichen in der Lage, die erworbenen Kenntnisse auch tatsächlich auf alltägliche Aufgaben anzuwenden? Ausgewertet werden die Untersuchungs-Ergebnisse unter der Berücksichtigung der sozialen Lern- und Lebensbedingungen der Jugendlichen in den einzelnen Teilnehmerstaaten.
Ziel ist also, vergleichbare Daten über die Ressourcenausstattung und deren individuelle Nutzung sowie über die Funktions- und Leistungsfähigkeit verschiedener Bildungssysteme zu liefern. Über die Beschreibung des Ist-Zustandes hinaus will PISA auch Veränderungen in Bildungssystemen sowie deren Folgen aufzeigen und damit Ansatzpunkte für Verbesserungen in Schulen liefern. Die Untersuchung ist daher konzeptionell in drei Projektzyklen bis zum Jahr 2006 angelegt. Der erste Zyklus (PISA 2000) hat insbesondere den Bereich Lesen in den Mittelpunkt gerückt. Mathematik und Naturwissenschaften bildeten lediglich Nebenkomponenten, auf die erst bei PISA 2003 beziehungsweise PISA 2006 fokussiert wird. Methodisch ist der Test eine Mischung: Der Fragebogen, den die Schüler in etwa 20 bis 30 Minuten auszufüllen hatten, enthält sowohl „Multiple Choice“-Aufgaben als auch Fragen, auf die ausformulierte Antworten verlangt wurden. Zudem wurden die Schulleiter um Auskünfte zu ihrer Schule gebeten.
Entwickelt wurde die Rahmenkonzeption des Tests, der alle Teilnehmerländer zustimmen mussten, durch eine internationale Expertengruppe unter Leitung von Raymond Adams vom Australian Council for Education Research. Weiterhin waren für das Design und die Implementierung der Erhebung folgende Forschungseinrichtungen zuständig: Netherlands National Institute for Eductional Measurement, Educational Testing Service (USA), National Institute for Educational Research (Japan) und WESTAT (USA).
Der internationale Leistungsvergleich wird erweitert durch nationale Ergänzungsstudien, die in allen teilnehmenden Staaten durchgeführt wurden und sich an den jeweiligen Lehrplänen orientieren.
Die Ergebnisse im einzelnen:
Lesekompetenz:
Die Fähigkeit einfache bis komplexe Texte zu verstehen, vom Herausfinden einer simplen Information oder der Identifizierung des jeweiligen Hauptthemas bis hin zur Informationsbewertung, Hypothesenbildung und der Anwendung spezieller Kenntnisse, ist in einer Kompetenzskala von 1 bis 5 differenziert. Die Stufe 1 bildet hier das niedrigste, die Stufe 5 das höchste Niveau ab. In einem zusammenfassenden Ranking nimmt Deutschland den Platz 21 ein und liegt damit „signifikant“, wie es im Forschungsbericht heißt, unter dem OECD-Durchschnitt und sechs Plätze beispielsweise hinter dem oft gescholtenen Bildungssystem der Vereinigten Staaten.
In der höchsten Kompetenzstufe (5), die für erstklassige Lesekompetenz steht, sind im OECD-Mittel zehn Prozent der Schüler einzuordnen. In Deutschland sind es nur neun, Spitzenreiter Finnland hat mit 18 Prozent einen doppelt so hohen Anteil an Schülern mit herausragenden Lesefähigkeiten. Besorgniserregender noch ist aber die Betrachtung der unteren Skala: Durchschnittlich waren in den Teilnehmerländern sechs Prozent der 15Jährigen noch unter dem Leistungsniveau 1, der niedrigsten Kompetenzstufe. In Deutschland sind es ganze zehn Prozent. Zählt man die Schüler, die noch die Stufe 1 erreicht haben ( 13 %), dazu, heißt das für die Bewertung der deutschen Bildungseinrichtungen: Jeder vierte Jugendliche kurz vor dem Ende seiner Pflichtschulzeit kann elementares Textverständnis nur bedingt oder gar nicht aufweisen. In Finnland weisen eine solche Leistungsschwäche nur sieben, in Kanada neun Prozent der Schüler auf.
Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenz:
Sowohl in der mathematischen als auch in der naturwissenschaftlichen Grundbildung, die in diesem ersten Untersuchungszyklus nur eine untergeordnete Rolle einnehmen, liegt Deutschland jeweils mit Platz 20 ebenfalls unterhalb des OECD-Leistungsdurchschnitts und im letzten Drittel des Ländervergleichs. Führend in der mathematischen Kompetenz sind Japan, gefolgt von Korea, die mit getauschter Rangfolge auch die Naturwissenschaften dominieren. Auch Finnland ist mit Platz vier und drei wieder stark vertreten. Detaillierte Vergleichsuntersuchungen zu diesen beiden Bereichen werden aber erst in den Jahren 2003 und 2006 erfolgen.
Insgesamt zeigten die Ergebnisse, dass eine hohe Gesamtleistung meist mit einer gleichmäßigen Verteilung der Ergebnisse einhergeht. So weisen etwa Länder wie Finnland, Japan und Korea ein vergleichsweise geringes Leistungsgefälle zwischen den besten und den schwächsten Schülern auf – bei einem hohen Durchschnittsniveau. Deutschland hingegen ist nach Meinung der OECD-Forscher eines der Länder mit dem größten Abstand zwischen den Besten und den Schwächsten und bleibt auch in der Gesamtleistung unter dem Länderdurchschnitt. Erklärt wird der größte Teil dieser Abweichung mit der Differenzierung des deutschen Schulsystems: „In Ländern“, so die Analyse der Studie, „die einem frühen Alter zwischen Schultypen differenzieren, scheinen die Unterschiede bei den Schülerleistungen und die Leistungsunterschiede zwischen den Schulen größer zu sein.“ Gemeinsam ist allen Ländern, dass Mädchen im Durchschnitt bei der Lesekompetenz besser sind als Jungen, während diese in der mathematischen Grundbildung ihren Mitschülerinnen voraus sind.
Bemerkenswert am Rande: Eines der an der Studie teilnehmenden Länder kann sich entspannt zurücklehnen und die Aufregung andernorts belächeln. Obwohl ein Niederländisches Institut in die Testentwicklung eingebunden worden war, findet sich das kleine Land an der Nordsee in der Statistik nur auf einem Sonderplatz: Die Qualität der Schülerleistung lasse sich mit den erarbeiteten Kriterien kaum erfassen, weil das niederländische Bildungssystem erheblich von allen anderen abweiche, so die Begründung der Forscher.
Aufgeregter waren zunächst die Reaktionen in Deutschland. Nach dem ersten Schock und den sich anschließenden Rufen nach schnellen Reformen im deutschen Bildungswesen bis hin zum Aufbruch der föderalen Struktur mahnen aber inzwischen Kritiker auch zur Zurückhaltung. So betonte etwa die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) Prof. Dr. Dagmar Schipanski die „Schlüsselrolle“ von Qualität bei der Ausbildung und Bildung vor dem Hintergrund einer sich wandelnde Gesellschaft. „Patentlösungen gibt es aber angesichts der Komplexität der Materie nicht, so Schipanski. Im zweiwochendienst warnt Prof. Dr. Rolf Wernstedt, Landtagspräsident in Niedersachsen und ehemals Kultusminister, vor bildungspolitischen Schnellschüssen. Die PISA-Studie solle zunächst einmal zum Nachdenken anregen. Der Hamburger Erziehungswissenschaftler Peter Struck hält sogar den Forschungsbericht für nicht aussagekräftig, weil die Schulsysteme verschiedener Länder und Kulturkreise nicht miteinander verglichen werden könnten. So sei etwa das gute Abschneiden von Japan und Korea bei den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten auf die dortigen „strengen Paukschulen“ zurückzuführen, die mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar wären.
Dennoch, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch: Die strategische Zielsetzung der EU-Bildungsminister „aber auch die Ergebnisse der PISA-Studie verlangen eine Bildungsoffensive auf nationaler und europäischer Ebene“, sagte am 14. Februar der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesbildungsministerium Wolf-Michael Catenhusen im EU-Bildungsministerrat.
PISA-E
Dass es bei der SchülerInnenleistungen erhebliche Unterschiede auch zwischen den Bundesländern gibt, hat die Ergänzungsstudie PISA-E offenbart, deren Ergebnisse am 27. Juni 2002 veröffentlicht wurden – zur internationalen Spitze konnte kein Bundesland aufschließen. Deutliche regionale Unterschiede innerhalb Deutschlands wurden nicht nur bei der Leistungsfähigkeit der Mädchen und Jungen festgestellt, sondern auch bei den Anteilen der SchülerInnen mit Hochschulreife oder ganz ohne Abschluss sowie bei den Bildungsinvestitionen. So zeigt die nach Bundesländern differenzierende Ergänzungsuntersuchung auch, dass innerhalb Deutschlands keine Chancengleichheit herrscht hinsichtlich der Aufwendungen je SchülerIn, der Anzahl der erteilten Unterrichtsstunden im Schulverlauf und etwa der Auswahl der Abituraufgaben. Ausführlich sind die Ergebnisse im zweiwochendienst Bildung Wissenschaft Kulturpolitik 11-12/02 dokumentiert.
Länderübersicht
Bayern
Als Konsequenz aus den Ergebnissen der PISA-Studie will Bayern „dem Kindergarten eine Bildungsaufgabe geben“ und Sprachförderung vor Schuleintritt sowie in Grund- und Hauptschule einführen. Die LehrerInnenaus- und –fortbildung soll den neuen Anforderungen entsprechend reformiert und - entgegen bisheriger Praxis im südlichen Bundesland – Ganztagsangebote ausgebaut werden. Eine 26-seitige Broschüre des Kultusministeriums (August 2002) informiert zu Ergebnissen und Folgerungen aus dem OECD-Leistungsvergleich. Zudem sind auf fünf Seiten (PISA und die innere Schulentwicklung) Handlungsfelder aus bayerischer Sicht skizziert.
zwd-Online exklusiv:
Lernen in Zeiten nach PISA heißt:
Anderes anders lernen
Die Kultusministerkonferenz sei das „Organisations-Bündel kontroverser Politiken“, meint der Pädagoge Otto Herz. Der Schlüssel zur Überwindung der schlechten PISA-Ergebnisse liege in der Entwicklung einer neuen Qualität der Lernkultur und nicht in einer vielerorts propagierten Verkürzung der Schulzeit. Im Gespräch mit dem zwd erinnert der freiberufliche Erziehungswissenschaftler unter anderem an die in den 70er Jahren von Hartmut von Hentig initiierte und von ihm maßgeblich mitgestaltete Bielefelder Laborschule und plädiert für eine ermutigende auf Vertrauen basierende Lernkutur.
Nationale Schulleistungsstudien - Erkenntnisse und notwendige Konsequenzen.
Die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz seien nicht ausreichend, meint Renate Hendriks. Im ihrem Kommentar zur PISA-E-Studie schreibt die Vorsitzende des Bundeselternrates exklusiv in zwd-Online: „Was fehlt, sind verbindliche Ziel- und Zeitvorgaben.“ Dort wo zeitliche Vorstellungen
geäußert worden seien wie bei der Entwicklung von verbindlichen Standards, seien diese zu langfristig geplant. Die föderale Struktur stehe schnelleren Übereinkünften offenbar im Weg. In ihrem Beitrag zählt die Diplom-Sozialpädagogin bildungspolitisch wichtige Handlungsfelder
auf und nennt Reformvorschläge für eine besseren Schul- und Unterrichtsqualität.
PISA-E - Standards? Zu welchem Ziel?
Die Aufstellung von Leistungsstandards ist nach Meinung von Ingrid Wenzler nicht der „Königsweg zum Erfolg“, wenn es um eine Reform des Bildungswesens geht. „Standards sind kein Ersatz für die Grundfrage, die in Deutschland zu klären ist: Wie ernsthaft gilt der Verfassungsauftrag
der Chancengleichheit im Bildungsbereich“, betont die Bundesvorsitzende der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule (GGG) in ihrem Kommentar zur PISA-E-Studie, den zwd-Online exklusiv veröffentlicht.
PISA 2003, der zweite Zyklus der folgenreichen OECD-Leistungsvergleichsstudie, ist längst aus der Planungsphase getreten. Inzwischen hat das deutsche PISA-Konsortium unter Federführung des Leipniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) in Kiel eine Webseite ins Netz gestellt, um über Fortschritte und Neuerungen der Folge-Studie zu informieren.
zweiwochendienst-Ausgaben zum Thema:
Nr. 15-16/01, Seite 3
Vor der PISA-Veröffentlichung: AfB problematisiert Schulleistungsvergleiche
Nr. 17-18/01, Seiten 2-13, 17-23, 26, 28
Stoiber: Zuwandererkinder verantwortlich für das schlechte Abschneiden der Deutschen; PISA forciert Debatte über föderale Struktur; Bildungsforscher warnen vor schnellen Rezepten; Prof. Dr. Rolf Wernstedt: Eine Aufforderung zum Denken; Eine Studie erschüttert die deutsche Bildungslandschaft (Dokumentation); GGG: Deutschland ist Spitze bei der sozialen Auslese; GEW: 10mal Qualität für bessere Schule; Kultusminister und Lehrerorganisationen einig; PISA II: SchülerInnenbefragungen, nun rücken auch die Eltern ins Kreuzfeuer.
Online-Beilage, Seite II
Zwd-Net-Service: PISA – Ergebnisse, Stellungnahmen, Kommentare, Reformvorschläge.
Nr. 19-20/01, Seite 13
VBE für neuen Bildungsrat
Online-Beilage, Seiten I-III
Blick über´n Zaun: Österreich und Finnland nach den PISA-Ergebnissen.
Nr. 1-2/02, Seite 31
Hans-Peter Bartels: Sozialdemokratische Bildungspolitik - Selbstkritik und Offensive.
Online-Beilage, Seite IV
Blick über´n Zaun: Kanada – Spitzenplatz bei PISA und bei den Bildungsausgaben.
Nr. 4-5/02, Seiten 5, 23, 28
PISA-E und Ganztagsschulen werden Wahlkampfthemen; Bundeskanzler Gerhard Schröder im Wortlaut auf dem Kongress „Mitte in Deutschland“; Kulturföderalismus: Brandenburgs Bildungsminister Steffen Reiche für landerübergreifende Schulstandards.
Nr. 6/02, Seiten 2-5
Bundeseinheitliche Standards für den Schulleistungsvergleich; Interview: Gerd Harms, Kultusminister in Sachsen-Anhalt, für nationale Bildungsberichterstattung
Online-Beilage, Seite VI
Bildungsrat für Niedersachsen
Nr. 7/02, Seiten 4-6
AfB-Bundeskonferenz: Schulstrukturen müssen auf den Prüfstand; NRW: „Das Fundament jeder Bildung“.
Online-Beilage, Seite II
Blick über´n Zaun: Schweden – Einheitsschule mit Erfolg
Nr. 8/02, Seiten 2, 4-5, 12
KMK plant eigenen Bildungsbericht; FDP-Bundesparteitag: Gegen Studiengebühren – für Auflösung der KMK, dazu der Kommentar von Jörg Tauss, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion; Mikrozensus: Bildung in sozialer Schieflage.
Nr. 9-10/02, Seiten 2-7, 20, 22-24
Bund stellt Länderkompetenz in Frage; PISA-E: Ergebnisse auf den ersten und den zweiten Blick; Bildungsetat steigt; Regierungserklärung des Bundeskanzlers: Gerechtigkeit durch Bildung; DGB-Bundeskongress: Gewerkschaftsbund fordert Bildungsreform; Signifikante Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen.
Bildung und Politik Online, Seiten IV-V
Blick über´n Zaun, zwd-Net-Service: Norwegen.
Nr. 11-12/02, Seiten 2-28 (PISA-E-Themenschwerpunkt)
KMK: Leistungsstandards bis 2004; Bundesbildungsministerium für nationale Antwort auf PISA-E; Prof. Dr. Rolf Wernstedt über den ungebildeten Umgang mit PISA; PISA-E: Die Bundesländer im Vergleich (Dokumentation); Interview: Prof. Hans-Günter Rolff „Die Gesamtschule in Deutschland kann nicht leben und nicht sterben“; McKinsey fordert Bildungsreform.
Nr. 13-14/02, Seite 28
5. Bericht zur Lage der AusländerInnen in Deutschland: Bessere Sprach- und Schulförderung.
Nr. 17, Seite 9
Debatte um Deutschlands Teilnahme am "PISA-Lehrertest".
Dokumente zum Thema:
Die Ergebnisse der OECD-Leistungsstudie PISA 2000 (367 Seiten)
PISA 2000: Zusammenfassung zentraler Befunde (51 Seiten)Link funktioniert nicht
Zusammenfassung der PISA-Ergänzungsstudie (PISA-E)
Pressespiegel zu den Reaktionen nach Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse Dezember 2001 bis Januar 2002 (774 Seiten; Zusammenstellung: OECD)
Stellungnahmen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zur PISA-Debatte (Dezember 2001 bis Juli 2002)
Die zwölf Empfehlungen des Forums Bildung
Michael Kanders / Hans-Günter Rolff: Mehr von allem, aber wenig ändern!
Ergebnisse der neuen IFS-Repräsentativbefragung zu Schule und Bildung(April 2002)
Weiterführende Links zum Thema:
OECD-Seite: www.pisa.oecd.org
OECD-Seite mit Links zu den nationalen Berichten: www.pisa.oecd.org/NatReports/cntry.htm
M-P-Institut (PISA Deutschland): www.mpib-berlin.mpg.de/pisa
Zusammenfassung PISA-E: www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/PISA_E_Zusammenfassung2.pdf
NRW-Angebot: http://www.learn-line.nrw.de/angebote/pisa/
Empfehlungen des Forum-Bildung: www.forum-bildung.de/new/html/01_empf/lz_01.html
Zusammenstellung: www.forum-bildung.de/themen/tpl_t117.php3
IPN (PISA 2003 Deutschland): www.ipn.uni-kiel.de/projekte/pisa/index.html
Deutscher Bildungsserver: www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1269
Informationssammlungen zu PISA vom Deutschen Bildungsserver: www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1273
PISA-Hamburg: www.hamburger-bildungsserver.de/schulentwicklung/welcome.phtml?rechts=/schulentwicklung/pisa
Bremen: www.bildung.bremen.de/pisa
NRW: www.mswf.nrw.de/aktuell/PISA-Reaktion.html
GEW: www.gew.de/standpunkt/aschlagzeilen/schule/pisa
PISA-Österreich: www.pisa-austria.at/index.htm
PISA-Schweiz: www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber15/pisa/pisa.htm