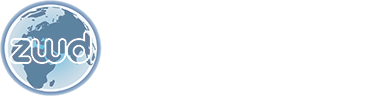zwd Berlin. Laut einer aktuellen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes waren 82 Prozent der im Jahr 2016 von Gewalt durch ihren Partner*innen betroffenen Menschen Frauen. Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes schätzt, dass 2017 allein in Deutschland mehr als 58.000 Mädchen von Genitalverstümmelung betroffen waren.
Das Deutsche Institut für Menschenrechte sieht Politik und Gesellschaft in der Verantwortung, eine effektive und koordinierte Strategie zur Prävention und Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt zu entwickeln. Das Institut schlug deshalb vor, auf Bundes- und Länderebene durch Aktionspläne eine effektive und koordinierte Strategie zur Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt zu entwickeln. Im Fokus sollten besonders weibliche Geflüchtete und Obdachlose sowie Frauen mit Behinderungen stehen. Dafür müsse etwa sichergestellt werden, dass alle betroffenen Frauen deutschlandweit Zugang zu Beratungs- und Schutzangeboten wie Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen erhalten.
Einen solchen Aktionsplan zur wirksamen Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen hielt auch der Deutsche Juristinnenbund erforderlich. Die Vereinigung forderte die kommende Bundesregierung auf, umgehend konkrete Maßnahmen, unter anderem durch Schaffung gesetzlicher Voraussetzungen und Strukturen für ein Leben frei von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen zu schaffen.
Interessensvertretung von Frauen mit Behinderung fordert barrierefreie Frauenhäuser
In der Istanbul Konvention sei festgeschrieben, dass niemand wegen seiner Behinderung diskriminiert werden dürfe und „besonders schutzbedürftige Gruppen“ bei allen Maßnahmen berücksichtigt werden müssten - das gebe Rückenwind für dringend notwendige Gewaltschutzmaßnahmen. Barrierefreie Frauenhäuser und Beratungsstellen, flächendeckende Präventionsmaßnahmen in und außerhalb von Einrichtungen sowie niedrigschwellige unabhängige Beschwerdestellen seien notwendig, hob Martina Puschke, Projektleiterin im Verein Weibernetz hervor. Die Konvention schreibe in Artikel 22 fest, dass es für alle Betroffenen von geschlechtsspezifischer Gewalt spezialisierte Hilfen geben müsse, die gut erreichbar und mit angemessenen Ressourcen ausgestattet seien. Als Dachverband sah der Verein Frauen gegen Gewalt (bff) besonderen Handlungsbedarf im ländlichen Raum. Hier fehle es an Fachberatungsstellen, an die Betroffene sich wenden könnten. Viele Fachberatungsstellen seien außerdem nicht barrierefrei und es fehle zudem das Geld für Dolmetscher*innen in der Beratung. Jetzt, da die Istanbul-Konvention geltendes Recht sei, müsse mehr Geld ins System fließen, erwartet die bff-Geschäftsführerin Katja Grieger.
Barley: „Gewalt gegen Frauen passiert unabhängig von Alter, sozialer Herkunft und Nationalität“
Die geschäftsführende Bundesfrauenministerin Katarina Barley (SPD) betonte, dass Gewalt gegen Frauen unabhängig von Alter, sozialer Herkunft und Nationalität passiere. Die Politik müsse Frauen Mut machen, ihr Schweigen zu brechen und ihnen Hilfe und Schutz bieten. „Sie brauchen einen Weg aus der Gewalt. Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Istanbul-Konvention bringt uns dabei weiter, doch müssen wir weitere Schritte gehen. Auch eine künftige Regierung muss den Schutz von Frauen vor Gewalt weiter verbessern“, so Barley. Um einen starken und einheitlichen Schutz vor Gewalt auch in Europa zu erreichen, sei es außerdem wichtig, dass alle 47 Mitgliedstaaten des Europarats die Konvention ratifizierten.
Die Istanbul Konvention sei nun geltendes deutsches Recht geworden, dies bedeute jedoch nicht, dass die Beteiligten ihre Hände in den Schoß legen könnten, mahnte die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF). Die SPD-Frauen erwarten, dass die Konvention mit einem nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in Deutschland umgesetzt werde. Nach der Ratifizierung komme es darauf an, dass das Recht konsequent angewandt werde. Deshalb forderte die ASF eine Fortbildungsverpflichtung für Angehörige von Justiz, Ermittlungsbehörden und Polizei. Außerdem müssten Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen in Zukunft besser ausgestattet und verlässlich finanziert werden.
Die SPD-Bundestagsfraktion versprach, sich für eine kraftvolle Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland einzusetzen. Die zuständige Berichterstatterin der Fraktion Gabriela Heinrich verwies darauf, dass ihre Partei und Fraktion lange für die Ratifikation der Konvention gekämpft hätten. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode seien auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion viele Verpflichtungen aus der Konvention umgesetzt worden wie beispielsweise die Reform des Sexualstrafrechts mit dem im Gesetz verankerten Prinzip ,Nein heißt Nein‘.
Schauws: „Strafrecht allein reicht nicht aus um Frauen zu schützen“
Das sei zwar ein sehr entscheidender Schritt für ein Mehr an sexueller Selbstbestimmung von Frauen und für die Stärkung von Betroffenen sexualisierter Gewalt gewesen, betonte die frauenpolitische Sprecherin Ulle Schauws (Grüne), doch das Strafrecht allein könne das Problem der sexualisierten Gewalt nicht lösen. Notwendig seien zusätzlich bestmögliche Prävention und mehr Opferschutz, so die Frauenexpertin. Viele Frauenhäuser müssten Frauen ablehnen, weil sie überbelegt seien. Von der neuen Bundesregierung erwarte Schauws, dass sie für eine solide Finanzierung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen auch über den Bund sorge. Von Gewalt betroffene geflüchtete Frauen und Mädchen sollten außerdem ein eigenständiges Aufenthaltsrecht bekommen.
Die insgesamt 81 Artikel der Istanbul-Konvention enthalten umfassende Verpflichtungen zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und betreffen zahlreiche Bereiche, wie das System der Unterstützung und Hilfe, etwa durch für Beratungsstellen und Frauenhäuser, auch für Frauen mit Behinderungen, das Umgangsrecht, den Opfer(zeug*innen)schutz, das Strafrecht, das Aufenthaltsrecht, die Fortbildung von Justiz und Verwaltung, und den wirksamen Zugang zum Recht für Gewaltbetroffene. Um die Istanbul-Konvention ratifizieren zu können, mussten die Regelungen der Konvention vorab vollständig in nationales Recht umgesetzt werden. Mit der Reform des Sexualstrafrechts wurde die letzte noch fehlende Voraussetzung erfüllt.