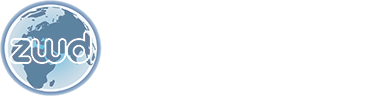Mit Zurückhaltung haben die Kultusministerien der Länder auf die jüngste Bildungsvergleichstudie „Bildungsmonitor 2013“ des den Arbeitgebern nahestehenden Institut der deutschen Wirtschaft (IW) reagiert. Die Studie hatte den CDU/CSU-geführten Ländern Sachsen, Thüringen und Bayern bescheinigt, unter allen Ländern der Bundesrepublik über die leistungsfähigsten Bildungssysteme zu verfügen. Die Hessischen Grünen nahmen das schlechte Abschneiden des Landes Hessen (Platz 9 unter allen Ländern) zum Anlass, einen Politikwechsel einzufordern.
Der von der wissenschaftlichen Abteilung des IW-Instituts unter Federführung von Prof. Axel Plünnecke im Auftrage der ‚Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft’ (INSM)erarbeitete ‚Bildungsmonitor 2013’ bestätigt den Ländern Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg die insgesamt besten Ergebnisse. Sachsen überzeuge mit exzellenten Ergebnissen in der Förderinfrastruktur, bei der Schulqualität und der Vermeidung von Bildungsarmut. Thüringen weise Bestwerte bei der Ausgabenpriorisierung und den Betreuungsbedingungen auf, Bayern sei Spitze bei der beruflichen Bildung und der Inputeffizienz, Baden-Württemberg bei der Internationalisierung. Aber auch andere Länder sind nach Angaben Plünneckes in Teilbereichen Vorbild – so Rheinland-Pfalz bei der Integration, Bremen im Bereich Hochschule/MINT, Berlin bei der Forschung und Schleswig-Holstein beim Effizienten Umgang mit Zeit im Bildungssystem.
‚Rote Laterne’ bei Berlin
Andererseits stellt die Studie dem Land Berlin das schlechteste Zeugnis aus – hinter Brandenburg (Platz 14 und dem Saarland (Platz 15). Zwischen dem besten und dem schlechtesten Bundesland liegt eine Spannweite von 27,4 Punkten auf einer 100er Skala: Sachsen hat dort ein Gesamtpunkteergebnis von 66,7, Berlin hingegen von 39,3 Punkten.
Laut Bildungsmonitor 2013 kommt es in den nächsten Jahren darauf an, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen und Bildungsarmut abzubauen. Zwar seien hier Erfolge zu verzeichnen – die Schulabbrecherquote sei zwischen 1005 und 20011 von 8,2 auf 6,0 Prozent gesunken, unter ausländischen Schulabbrechern sank die Quote sogar von 17,4 auf 11,8 Prozent. Es bestehe aber „kein Grund zu Entwarnung“, stellte Plünnecke klar. Auch wenn die Gesamtzahl bildungsarmer junger Erwachsener gegenüber 2005 um 300.000 auf 1,3 Millionen im Jahre 2011gefallen sei, gelte es, das Potenzial der jungen erwachsenen ohne Berufsausbildung durch Qualifizierungsmaßnahmen stärker für den Arbeitsmarkt nutzbar zu machen. Der IW-Forscher erinnerte in diesem Zusammenhang an den wachsenden Fachkräftemangel. Immerhin sei durch Reduzierung der Bildungsarmut im Jahr 2011 ein Wertschöpfungsbeitrag in Höhe von 3,3 Milliarden Euro bewirkt worden. Eine Erhöhung des Fachkräftepotenzials verspricht sich Plünnecke sowohl davon, dass ältere Fachräfte durch Bildung in der zweiten Lebenshälfte länger im Arbeitsmarkt gehalten werden können, als auch von der Beibehaltung des Abiturs nach zwölf Schuljahren.
Auf zwd-Nachfrage bestätigte der IW-Abteilungsleiter, dass im Rahmen des Bildungsmonitors 2013 – den es inzwischen seit zehn Jahren gibt -, keine geschlechtsspezifischen Daten erhoben worden und somit auch nicht verfügbar sind. Man wolle „die Anregung“ aber aufnehmen und für die Zukunft erwägen.
INSM für Abschaffung der Verbeamtung von Lehrer_innen
Aus Sicht der Initiative INSM steht die künftige Bundesregierung vor zentrale bildungspolitischen Reformaufgaben. Der Geschäftsführer der Initiative, Hubertus Pellengahr, nannte als wichtigste Aufgaben
eine Verlagerung der Bildungsinvestitionen in die ersten Lebensjahre: ,Es muss uns gelingen, die Vererbung schwacher Bildungsbiografien zu durchbrechen“
für eine leistungsorientierte Vergütung von Lehrkräften und insbesondere die Abschaffung der Verbeamtung von Lehrer_innen
die Schaffung von mehr Wettbewerb im Schulsystem durch Gewährung von größerer Freiheit.
Der von der wissenschaftlichen Abteilung des IW-Instituts unter Federführung von Prof. Axel Plünnecke im Auftrage der ‚Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft’ (INSM)erarbeitete ‚Bildungsmonitor 2013’ bestätigt den Ländern Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg die insgesamt besten Ergebnisse. Sachsen überzeuge mit exzellenten Ergebnissen in der Förderinfrastruktur, bei der Schulqualität und der Vermeidung von Bildungsarmut. Thüringen weise Bestwerte bei der Ausgabenpriorisierung und den Betreuungsbedingungen auf, Bayern sei Spitze bei der beruflichen Bildung und der Inputeffizienz, Baden-Württemberg bei der Internationalisierung. Aber auch andere Länder sind nach Angaben Plünneckes in Teilbereichen Vorbild – so Rheinland-Pfalz bei der Integration, Bremen im Bereich Hochschule/MINT, Berlin bei der Forschung und Schleswig-Holstein beim Effizienten Umgang mit Zeit im Bildungssystem.
‚Rote Laterne’ bei Berlin
Andererseits stellt die Studie dem Land Berlin das schlechteste Zeugnis aus – hinter Brandenburg (Platz 14 und dem Saarland (Platz 15). Zwischen dem besten und dem schlechtesten Bundesland liegt eine Spannweite von 27,4 Punkten auf einer 100er Skala: Sachsen hat dort ein Gesamtpunkteergebnis von 66,7, Berlin hingegen von 39,3 Punkten.
Laut Bildungsmonitor 2013 kommt es in den nächsten Jahren darauf an, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen und Bildungsarmut abzubauen. Zwar seien hier Erfolge zu verzeichnen – die Schulabbrecherquote sei zwischen 1005 und 20011 von 8,2 auf 6,0 Prozent gesunken, unter ausländischen Schulabbrechern sank die Quote sogar von 17,4 auf 11,8 Prozent. Es bestehe aber „kein Grund zu Entwarnung“, stellte Plünnecke klar. Auch wenn die Gesamtzahl bildungsarmer junger Erwachsener gegenüber 2005 um 300.000 auf 1,3 Millionen im Jahre 2011gefallen sei, gelte es, das Potenzial der jungen erwachsenen ohne Berufsausbildung durch Qualifizierungsmaßnahmen stärker für den Arbeitsmarkt nutzbar zu machen. Der IW-Forscher erinnerte in diesem Zusammenhang an den wachsenden Fachkräftemangel. Immerhin sei durch Reduzierung der Bildungsarmut im Jahr 2011 ein Wertschöpfungsbeitrag in Höhe von 3,3 Milliarden Euro bewirkt worden. Eine Erhöhung des Fachkräftepotenzials verspricht sich Plünnecke sowohl davon, dass ältere Fachräfte durch Bildung in der zweiten Lebenshälfte länger im Arbeitsmarkt gehalten werden können, als auch von der Beibehaltung des Abiturs nach zwölf Schuljahren.
Auf zwd-Nachfrage bestätigte der IW-Abteilungsleiter, dass im Rahmen des Bildungsmonitors 2013 – den es inzwischen seit zehn Jahren gibt -, keine geschlechtsspezifischen Daten erhoben worden und somit auch nicht verfügbar sind. Man wolle „die Anregung“ aber aufnehmen und für die Zukunft erwägen.
INSM für Abschaffung der Verbeamtung von Lehrer_innen
Aus Sicht der Initiative INSM steht die künftige Bundesregierung vor zentrale bildungspolitischen Reformaufgaben. Der Geschäftsführer der Initiative, Hubertus Pellengahr, nannte als wichtigste Aufgaben