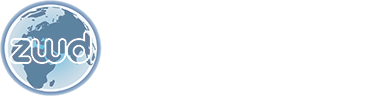zwd Berlin. "Rassismus, Antisemitismus und Israelfeindlichkeit haben keinen Platz an Schulen und Hochschulen", heißt es im Abschnitt zur Demokratiebildung im Koalitionsvertrag. Judenfeindschaft zu bekämpfen, bilde eine "gesamtgesellschaftliche Aufgabe", auch im Hochschulbereich, erklärte Bundesbildungsminister Özdemir anlässlich der Veröffentlichung der Studie am 09. April. Zwar hätten antisemitische Einstellungen bei Student:innen nicht zugenommen und seien weniger stark verbreitet als im Bevölkerungsmittel. Dennoch seien sie weiterhin problematisch, Judenhass und Israelfeindlichkeit dürfe man an den Hochschulen nicht tolerieren. Özdemir begrüßte, dass viele der Universitäten und Fachhochschulen "bereits sehr engagiert im Kampf gegen Antisemitismus" seien, und rief sie auf, "die erfolgreichen Maßnahmen (...) auszubauen" und dafür zu sorgen, dass sie unter den Angehörigen der Hochschulen bekannt würden.
Wie die von Forscher:innen der Universität Konstanz unter der Leitung von Prof. Thomas Hinz durchgeführte Studie zeigt, kam es seit dem 07. Oktober 2023 an 49 Prozent der Unis und 33 Prozent der Fachhochschulen zu antisemitischen Vorfällen, die in erster Linie auf dem Gelände angebrachte Graffitis, Plakate und Aufkleber (Uni: 44, FH: 28 Prozent) beinhalteten, aber auch antisemitische Parolen (Uni: 12, FH: 8 Prozent), verbale Angriffe auf jüdische Studierende (Uni: 15, FH: 3 Prozent) und Lehrkräfte(Uni: 2, FH: 3 Prozent) sowie vereinzelt Gewalt gegen jüdische Student:innen (Uni: 2 Prozent).
Hochschul-Jusos: Antisemitismus-Beauftragte gesetzlich verankern
Der Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) Prof. Georg Krausch betonte die Verantwortung der Bildungsinstitutionen: Sie stünden dafür ein, dass sich "jüdische Studierende und Mitarbeitende auf jedem Campus sicher fühlen". Krausch mahnte, dass "Bekenntnisse allein (...) die (…) vorgestellten Zahlen und die dahinter liegende Geisteshaltung nicht verändern" würden. Grenzüberschreitungen seien deutlich zu benennen und nachzuverfolgen. Für die HRK stellten jedoch auf die Dauer "Aufklärung durch Forschung, antisemitismuskritische Bildung und die Weitervermittlung von Diskursstandards" die bevorzugten Mittel dar. Etwas schärfer forderten die Hochschulgruppen der Jusos als Reaktion auf die Umfrageergebnisse "konkrete Taten zur Bekämpfung von Antisemitismus".
Das Bundesvorstandsmitglied Emma Würfel beklagte, dass viele Studen:innen die an Hochschulen vorhandene Judenfeindlichkeit eindeutig unterschätzten. Dies beurteilte sie nicht nur als "besorgniserregend", sondern auch als "konkrete Gefahr für jüdische Studierende und Lehrende". Antisemitische Vorfälle würden zu häufig keine Konsequenzen nach sich ziehen und "jüdische Studierende (...) im Stich gelassen". Ihr Vorstandskollege bei den Hochschul-Jusos Benno Heumann konstatierte, es würden „dringend flächendeckend (...) Anlaufstellen zur Antisemitismusbekämpfung" gebraucht. Antisemitismus-Beauftragte müssten "in den Hochschulgesetzen verankert" werden. Darüber hinaus sei auch "aktives Präventionshandeln" erforderlich. Daher verlangten die Juso-Hochschulgruppen "mehr Bildungsarbeit" in Hinsicht auf Antisemitismus, den Konflikt in Nahost sowie jüdisches Leben.
SPD fordert stärkere Prävention und Sensibilisieren für Antisemitismus
Die Präsidentin der Wissenschafts-Ministerkonferenz (Wissenschafts-MK) und Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern Bettina Martin (SPD) sprach sich gleichfalls für verbesserte "Prävention gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit" aus ebenso wie für eine Sensibilisierung für Judenfeindschaft. Sie verwies auf den von der Wissenschafts-MK schon im Dezember vor einem Jahr beschlossenen Aktionsplan, in dem die Minister:innen für wirksameren Schutz jüdischer Student:innen und Mitarbeiter:innen "den Ausbau von Melde- und Beratungsstrukturen an den Hochschulen" empfahlen. Die Umfrage belege „eine starke Betroffenheit von Hochschulen durch antisemitische Vorfälle“, die gemessenen „antisemitischen Ressentiments sind auf konstantem Niveau“, resümiert das Autor:innenteam: Es sei „weiterhin hohe Wachsamkeit angezeigt – insbesondere gegenüber israelbezogenem Antisemitismus“.
Mehr Studierende kritisieren israelischen Militäreinsatz in Gaza
Die emotionale Anteilnahme der Studierenden an der Nahost-Krise verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um12 Prozent auf 47 Prozent (2023: 59 Prozent), dafür stieg ihre Sorge, dass sich der Konflikt auf die benachbarten Länder der Region (64 Prozent, 2023: 57 Prozent) ausweiten könnte, und den Überfall der Hamas auf Israel verurteilen immer noch 70 Prozent (2023: 71 Prozent) als einen „verabscheuungswürdigen Terrorakt“. Andererseits bewerten inzwischen ca. zwei Drittel der Student:innen (65 Prozent, 2023: 58 Prozent) den israelischen Militäreinsatz in Gaza aufgrund des unter der palästinensischen Zivilbevölkerung verursachten Leides kritisch, und über zwei Fünftel (46 Prozent, 2023: 35 Prozent) optieren dafür, die militärische Kooperation mit Israel zu stoppen. Demgegenüber schätzen Studierende offenbar das Phänomen des Antisemitismus an den Hochschulen nicht adäquat ein: Lediglich 13 Prozent der Befragten gaben an, antijüdische Vorfälle an ihrer Universität oder Fachhochschule beobachtet zu haben. 2 Prozent erlebten direkt Ausgrenzung jüdischer Student:innen, 8 Prozent hörten mittelbar davon.
Geringe Beteiligungsquote von Student/innen an Nahost-Protesten
Zwei Drittel (65 Prozent) der Universitäten und ein Viertel (25 Prozent) der Fachhochschulen berichteten über pro-palästinensische Proteste, an denen sich im universitären Milieu über zwei Fünftel (42 Prozent) Nicht-Hochschulangehörige beteiligten. Dabei unterstützt die überwiegende Mehrheit der Studierenden (56 Prozent) den Daten zufolge nicht die Nahost-bezogenen Kundgebungen. Nur wenige Student:innen wirkten an pro-palästinensischen (4 Prozent) oder pro-israelischen (1 Prozent) Aktionen mit, über ein Fünftel (22 Prozent) befürwortet allerdings Protestversammlungen der ersten, unter einem Zehntel (8 Prozent) Aktivitäten der zweiten Gruppierung.
Die Forscher:innen befragten im Auftrag des Bundesbildungsministeriums (BMBF) vom 09. Dezember 2024 bis zum 07. Januar 2025 - ähnlich wie bei der Vorläufererhebung vom Dezember 2023 - 1.885 auf einem Online-Access-Panel registrierte Studierende, welche einer Einladung zu der Antisemitismus-Studie folgten, und eine Vergleichsgruppe von 2.031, beim gleichen Panelbetreiber angemeldete, ab 18-jährige Personen der Gesamtbevölkerung. Zeitgleich fand eine Online-Umfrage unter Hochschulleitungen statt. Von 271 Mitgliedsinstitutionen der HRK beteiligten sich insgesamt 94 Hochschulen (35 Prozent), 41 von 84 Universitäten (49 Prozent), 40 von 118 Fachhochschulen (34 Prozent) und 13 weitere Einrichtungen, z.B. Kunst-, Musik- und Duale Hochschulen, Berufsakademien (19 Prozent).
Halb so viel Antisemitismus bei Studierenden wie in Bevölkerung
Allgemein veränderten sich antisemitische Haltungen unter Studierenden nach Angaben der Studie seit 2023 mit 17 Prozent tendenziellen oder ausgeprägten antijüdischen Ressentiments (2023: 18 Prozent) kaum. Ihre Werte liegen weniger als halb so hoch wie in der Gesamtbevölkerung (39 Prozent, 2023: 38 Prozent). 83 Prozent der studentischen Befragten (2023: 82) galten den Forscher:innen als nicht-antisemitisch, gegenüber nur 61 Prozent der Vergleichsgruppe aus der Bevölkerung (2023: 62 Prozent). Israelbezogener Antisemitismus ist umgekehrt unter Studierenden mit 18 Prozent etwas stärker vertreten und seit einem Jahr (2023: 17 Prozent) leicht gestiegen, in der Gesamtbevölkerung sind die Anteile mit 25 Prozent (2023: 20 Prozent) ein wenig höher. Die Gruppe der nicht-antiisraelischen Student:innen (82 Prozent, 2023: 83 Prozent) ist ungefähr gleich groß wie die der allgemein nicht-antijüdischen und hat sich im Verhältnis zu 2023 geringfügig reduziert.
Während 47 Prozent der Universitäten und 58 Prozent der Fachhochschulen nach Aussagen der Leiter:innen eine:n Antisemitismus-Beauftragte:n ernannten, 23 Prozent der Unis bzw. 39 Prozent der FHs über eine Anlaufstelle zum Bekämpfen antisemitischer Tendenzen (meist an die Antidiskriminierungs-Beauftragten angegliedert) verfügen und über die Hälfte weitere Maßnahmen, wie Informationsveranstaltungen und Diskussionsrunden (69 Prozent) oder offizielle Stellungnahmen (52 Prozent), ergriffen, hatten bloß gut ein Fünftel (21 Prozent) der befragten Studierenden Kenntnis von Informationsveranstaltungen zu israelbezogenem Antisemitismus, 15 Prozent vom Vorhandensein eines/ einer Antisemitismus-Beauftragten, 12 Prozent von angedrohten Sanktionen wegen antisemitischer Äußerungen und 11 Prozent von einer eingerichteten Melde- und Beratungsstelle für antijüdische/ antiisraelische Vorfälle.