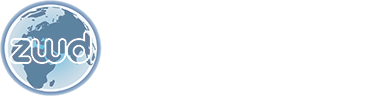Es gibt keine absolute Sicherheit – ein Satz, der uns dieser Tage immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Aber wir sind nicht machtlos, müssen nicht lethargisch zuschauen, was um uns herum passiert. Nicht nur die Politik ist gefordert, nicht nur die staatliche Bürokratie muss aus Fehlern lernen, auch wir alle als mündige MitbürgerInnen müssen klare Kante zeigen für unsere demokratischen Werte und gegen die Parolen aus Angst und Rechtspopulismus aufstehen. Ein wesentlicher Ansatz gegen Staats- und Politikverdrossenheit ist, die Modernisierung der Verwaltung massiv voranzutreiben und auf der Agenda der wichtigsten Aufgaben ganz nach oben rücken.
Die Berliner Verwaltung hat das bitter nötig.
Es ist ein Lichtpunkt, dass die Berliner SPD, Linken und Grünen in ihrem Koalitionsvertrag ihre Entschlossenheit bekundet haben, eine leistungsfähige Verwaltung und einen modernen öffentlichen Dienst zu schaffen. Der Erfolg dieser anspruchsvollen Zielsetzung wird daran gemessen werden, wieweit eine moderne Verwaltung auch das Gefühl zu vermitteln vermag, dass sie für die Bürgerinnen und Bürger da ist und nicht umgekehrt. Das gilt auch für ein funktionierendes Bildungswesen. Angesichts der wachsenden Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund, z.B. in Willkommensklassen, ist eine Neujustierung unserer Bildungsangebote zwingend. Es geht einerseits darum, dem unveränderten Sozialausleseprozess, entgegen zu steuern. Andererseits betrifft das die geschlechtersensible Vermittlung unserer demokratischen Werte (einschließlich Frauengleichstellung) ebenso wie den Anspruch, der umfassenden Digitalisierung aller Lebensbereiche gerecht zu werden. LehrerInnen müssen durch Fort- und Weiterbildung qualifiziert werden, aber auch geschützt werden. Denn es kann nicht sein, dass Gewalt – auch gegen Lehrkräfte – verstärkt zum Alltag von Schule gehört. Je deutlicher es der Bildungspolitik gelingt, hier gegenzusteuern, desto eher wird das Vertrauen in das politische und Verwaltungshandeln zurückzugewinnen sein. Desto eher kann auch rechtspopulistischen Parolen Einhalt geboten werden.
Ein Lichtpunkt: Die Änderung des 104 c GG
Zweifellos ein Lichtpunkt ist, dass sich gegen Jahresschluss Länder und Bund auf eine Änderung des Grundgesetzartikels 104c verständigt haben, wodurch nun Schulinvestitionen in finanzschwachen Kommunen von Bundesseite verfassungsrechtlich möglich werden. Für dieses Aufbrechen des unvernünftigen Kooperationsverbots hatten SPD sowie Grüne und Linke seit vielen Jahren gekämpft. Am Ende zeigt sich, dass sich gerechtere Bildungschancen nicht an parteipolitischen Grenzen aufhalten lassen.
Ein Vergleich der Kolaitionsverträge von 2016, die nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin geschlossen worden sind, gibt Aufschluss darüber, dass die Hauptstadt das frauen- und gleichstellungspolitisch ambitionierteste Programm erhält. Berlin war in diesem Punkt häufig schon weiter als der Rest der Republik. Durch die Zusammensetzung des Senats mit einer 6:4-Frauenmehrheit hat Regierungschef Michael Müller (SPD) ein Zeichen gesetzt. Denn eine Geschlechterparität in Landesregierungen ist keineswegs selbstverständlich. Das zeigen die Beispiele in Mecklenburg-Vorpommern (SPD & CDU) und Sachsen-Anhalt (CDU, SPD & Grüne). Auch in der SPD-geführten Landesregierung von Niedersachsen blieb 2015 die paritätische Zusammensetzung des Kabinetts auf der Strecke. Die Lernprozesse sind also auch in der SPD noch nicht abgeschlossen, aber die Partei scheint schon auf einem guten Weg, nicht zuletzt dank ihrer frauenpolitisch bewegten Generalsekretärin Katarina Barley im Verein mit der Bundesgeschäftsführerin Juliane Seifert. Nicht von ungefähr ist die Union bemüht, über ihre Rolle als Kanzlerin-Wahlverein hinaus Akzente zu setzen. Eine maßgebliche Rolle kommt dabei Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters (CDU) zu, die begonnen hat, Veränderungen in Richtung auf mehr Frauenteilhabe im Kunst- und Kulturbereich anzustoßen. Ein Lichtpunkt: Ihre Initiative für einen „runden Tisch“ der Kulturschaffenden im Kanzleramt.
Lichtpunkt: Bundesfrauengesundheitsbericht
Auch in einem sogenannten harten Politikbereich der Gesundheitspolitik, in dem das Stichwort „Frauengleichstellung“ bislang noch unterbelichtet ist, deutet sich eine Trendwende an. Nach Veröffentlichung des Berichts „Gesundheit in Deutschland“ im November 2015 hatte das zwd-POLITIKMAGAZIN eine umfassenden Analyse vorgenommen, um frauenspezifische Besonderheiten und Defizite dieses vom Robert-Koch-Institut herausgegebenen Berichts herauszuarbeiten (vgl. zwd-Ausgabe 336 vom Februar 2015). Wie unsere Veröffentlichung blieb auch eine Initiative des Nationalen Netzwerkes Frauen und Gesundheit zunächst scheinbar ohne Resonanz. Es hatte am 17. Juni dieses Jahres Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe in einem Brief gemahnt, 15 Jahre nach Erscheinen des letzten Bundesfrauengesundheitsberichts von 2001 dessen Neuauflage zu veranlassen. Das Achselzucken der verantwortlichen ParlamentarierInnen setzte sich sogar noch fort, als wir im November vergeblich um Stellungnahmen zu unserer Debattenfrage baten. Auch das Robert-Koch-Institut quittierte unsere Anfrage mit Schweigen.