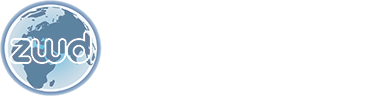Vor allem ärmere Frauen tragen noch immer die Hauptlast unbezahlter Hausarbeit. Nach einer international vergleichenden Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) können sie sich „keine bezahlte Hilfe leisten, und Zugang zu arbeitssparenden Haushaltsgeräten haben sie nur in den reicheren Ländern“. Wohlhabende Frauen dagegen – so ein weiteres Ergebnis – könnten auf Haushaltshilfen und -technologien zurückgreifen.
Gerade in Ländern mit großen ökonomischen Ungleichheiten wie Brasilien oder Chile seien arme Frauen besonders belastet, konstatierte der WZB-Forscher Jan Paul Heisig und ergänzte: „Ihr Einkommen reicht nicht aus, um arbeitssparende Haushaltsgeräte zu finanzieren; teilweise fehlt es sogar an der notwendigen Grundversorgung mit Wasser und Strom“. Reiche Haushalte dagegen profitierten in diesen Ländern von einem großen Angebot an unqualifizierten Arbeitskräften, die häusliche Dienstleistungen zu niedrigen Löhnen anbieten.
Industrieländer: Unterschiede fallen kleiner aus
Kleiner sind die Unterschiede der Studie zufolge in Industrieländern wie Deutschland oder Schweden, weil hier auch die unteren Einkommensschichten über arbeitssparende Haushaltsgeräte verfügten und weniger Zeit für Hausarbeit aufwenden müssten. „Dieser Befund widerspricht der gängigen Auffassung, die Ausbreitung von Haushaltstechnologien habe in erster Linie zu einer Erhöhung der Haushaltsstandards, kaum aber zu einer Verringerung der häuslichen Arbeitszeit geführt“, lautete das Fazit von Heisig. Indirekt stützten die Ergebnisse zudem die These, dass technologische Innovationen wesentlich zum Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit in den vergangenen 100 Jahren beigetragen haben.
Für seine Studie über den Zusammenhang zwischen Haushaltseinkommen und Hausarbeitszeit hat der WZB-Forscher Jan Paul Heisig Daten aus 33 Ländern ausgewertet. Das ärmste Zehntel der Frauen arbeitet im Durchschnitt etwa 7,7 Stunden pro Woche mehr im Haushalt als das reichste Zehntel eines Landes.
Gerade in Ländern mit großen ökonomischen Ungleichheiten wie Brasilien oder Chile seien arme Frauen besonders belastet, konstatierte der WZB-Forscher Jan Paul Heisig und ergänzte: „Ihr Einkommen reicht nicht aus, um arbeitssparende Haushaltsgeräte zu finanzieren; teilweise fehlt es sogar an der notwendigen Grundversorgung mit Wasser und Strom“. Reiche Haushalte dagegen profitierten in diesen Ländern von einem großen Angebot an unqualifizierten Arbeitskräften, die häusliche Dienstleistungen zu niedrigen Löhnen anbieten.
Industrieländer: Unterschiede fallen kleiner aus
Kleiner sind die Unterschiede der Studie zufolge in Industrieländern wie Deutschland oder Schweden, weil hier auch die unteren Einkommensschichten über arbeitssparende Haushaltsgeräte verfügten und weniger Zeit für Hausarbeit aufwenden müssten. „Dieser Befund widerspricht der gängigen Auffassung, die Ausbreitung von Haushaltstechnologien habe in erster Linie zu einer Erhöhung der Haushaltsstandards, kaum aber zu einer Verringerung der häuslichen Arbeitszeit geführt“, lautete das Fazit von Heisig. Indirekt stützten die Ergebnisse zudem die These, dass technologische Innovationen wesentlich zum Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit in den vergangenen 100 Jahren beigetragen haben.
Für seine Studie über den Zusammenhang zwischen Haushaltseinkommen und Hausarbeitszeit hat der WZB-Forscher Jan Paul Heisig Daten aus 33 Ländern ausgewertet. Das ärmste Zehntel der Frauen arbeitet im Durchschnitt etwa 7,7 Stunden pro Woche mehr im Haushalt als das reichste Zehntel eines Landes.