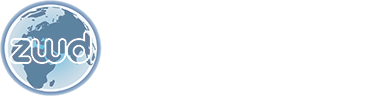125 Millionen Mädchen und Frauen in Afrika und auf der Arabischen Halbinsel leiden unter einer Genitalverstümmelung – jährlich werden 3 Millionen Mädchen der Prozedur der Beschneidung unterzogen. Die Hälfte von ihnen ist dabei jünger als 5 Jahre alt, die andere Hälfte zwischen 5 und 15 Jahren. Zu diesem Befund kommt ein Ende Juli veröffentlichter Bericht der Unicef, der die Ergebnisse einer breit angelegten Studie zur Genitalverstümmelung vorstellt. Zum ersten Mal in diesem Umfang sind Daten aus 29 Ländern auf dem afrikanischen Kontinent und der Arabischen Halbinsel ausgewertet worden, in denen die weibliche Beschneidung hauptsächlich praktiziert wird.
Am meisten verbreitet ist die rituelle Beschneidung laut Bericht im subsaharischen Afrika und Ägypten, von Senegal an der Westküste bis Somalia an der Ostküste und südlich bis Tansania, aber auch im Jemen und im Irak ist die Praktik bekannt. In einigen Ländern liegt die Rate der Mädchen und Frauen mit Genitalverstümmelung bei über 90 Prozent der weiblichen Bevölkerung, so in Somalia (98 Prozent), Guinea (96 Prozent), Djibuti (93 Prozent) und Ägypten (91 Prozent), wie aus dem Bericht hervorgeht. In Ägypten sind damit 27,2 Millionen Mädchen und Frauen betroffen, die größte Gruppe der 125 Millionen Beschnittenen insgesamt, gefolgt von Äthiopien mit 23,8 Millionen, Nigeria mit 19,9 Millionen und Sudan mit 12,1 Millionen.
Religiöse Autoritäten verurteilen weibliche Beschneidung
Obwohl die weibliche Beschneidung in vielen Fällen mit religiöser Pflichterfüllung begründet werde, gäbe es von religiösen Autoritäten keinerlei Rückhalt für die Praktik. So hat beispielsweise die höchste Instanz in Ägypten für Islamisches Recht, die Al-Azhar-Universität, 2007 eine Fatwa (islamisches Rechtsgutachten) herausgegeben, welche die Praktik der weiblichen Beschneidung explizit verurteilt und klarstellt, dass sie keinerlei Basis in der Scharia oder anderen islamischen Gesetzgebung hat. Der Unicef-Bericht hebt hervor, dass weibliche Beschneidung nicht nur von Muslimen, sondern zum großen Teil auch von Christen praktiziert wird. Außerdem sei festzustellen, dass die Praktik in finanziell schwächeren und bildungsferneren Bevölkerungsschichten verbreiteter ist.
Die Mehrzahl der Beschneidungen werde zu Hause mit einem Messer oder einer Rasierklinge vorgenommen, aufgrund der hygienischen Bedingungen mit teilweise drastischen unmittelbaren Konsequenzen für die Gesundheit. Der Bericht unterscheidet dabei zwischen Klitoridektomie (Entfernung der Klitoris), Beschneidung (Entfernung von Klitoris und inneren Schamlippen) und Infibulation (Entfernung von Klitoris und allen Schamlippen, anschließendes Vernähen der Vaginalöffnung) und hält sich dabei an die von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) etablierten Kategorien.
Die Studie hat auch ein positives Ergebnis zu verzeichnen: Laut neuesten Umfragen schwindet die gesellschaftliche Akzeptanz für die Praktik der weiblichen Beschneidung. In manchen Ländern, darunter Guinea, Sierra Leone und Tschad, sind es vor allem Männer, die ein Ende der Praktiken fordern, wie die Statistiken der Studie zeigen. Auch die rechtliche Lage habe sich seit Mitte der 1990er Jahre deutlich verändert. So sei in 24 Ländern Genitalverstümmelung inzwischen gesetzlich verboten. Jedoch kommt der Unicef-Bericht auch zu dem Schluss, dass die rechtliche Verurteilung allein nicht ausreiche, und fordert daher umfassende Aufklärungs- und Bildungsprojekte.
Der Unicef-Bericht steht in englischer Sprache im Netz unter: Female Genital Mutilation/Cutting
Am meisten verbreitet ist die rituelle Beschneidung laut Bericht im subsaharischen Afrika und Ägypten, von Senegal an der Westküste bis Somalia an der Ostküste und südlich bis Tansania, aber auch im Jemen und im Irak ist die Praktik bekannt. In einigen Ländern liegt die Rate der Mädchen und Frauen mit Genitalverstümmelung bei über 90 Prozent der weiblichen Bevölkerung, so in Somalia (98 Prozent), Guinea (96 Prozent), Djibuti (93 Prozent) und Ägypten (91 Prozent), wie aus dem Bericht hervorgeht. In Ägypten sind damit 27,2 Millionen Mädchen und Frauen betroffen, die größte Gruppe der 125 Millionen Beschnittenen insgesamt, gefolgt von Äthiopien mit 23,8 Millionen, Nigeria mit 19,9 Millionen und Sudan mit 12,1 Millionen.
Religiöse Autoritäten verurteilen weibliche Beschneidung
Obwohl die weibliche Beschneidung in vielen Fällen mit religiöser Pflichterfüllung begründet werde, gäbe es von religiösen Autoritäten keinerlei Rückhalt für die Praktik. So hat beispielsweise die höchste Instanz in Ägypten für Islamisches Recht, die Al-Azhar-Universität, 2007 eine Fatwa (islamisches Rechtsgutachten) herausgegeben, welche die Praktik der weiblichen Beschneidung explizit verurteilt und klarstellt, dass sie keinerlei Basis in der Scharia oder anderen islamischen Gesetzgebung hat. Der Unicef-Bericht hebt hervor, dass weibliche Beschneidung nicht nur von Muslimen, sondern zum großen Teil auch von Christen praktiziert wird. Außerdem sei festzustellen, dass die Praktik in finanziell schwächeren und bildungsferneren Bevölkerungsschichten verbreiteter ist.
Die Mehrzahl der Beschneidungen werde zu Hause mit einem Messer oder einer Rasierklinge vorgenommen, aufgrund der hygienischen Bedingungen mit teilweise drastischen unmittelbaren Konsequenzen für die Gesundheit. Der Bericht unterscheidet dabei zwischen Klitoridektomie (Entfernung der Klitoris), Beschneidung (Entfernung von Klitoris und inneren Schamlippen) und Infibulation (Entfernung von Klitoris und allen Schamlippen, anschließendes Vernähen der Vaginalöffnung) und hält sich dabei an die von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) etablierten Kategorien.
Die Studie hat auch ein positives Ergebnis zu verzeichnen: Laut neuesten Umfragen schwindet die gesellschaftliche Akzeptanz für die Praktik der weiblichen Beschneidung. In manchen Ländern, darunter Guinea, Sierra Leone und Tschad, sind es vor allem Männer, die ein Ende der Praktiken fordern, wie die Statistiken der Studie zeigen. Auch die rechtliche Lage habe sich seit Mitte der 1990er Jahre deutlich verändert. So sei in 24 Ländern Genitalverstümmelung inzwischen gesetzlich verboten. Jedoch kommt der Unicef-Bericht auch zu dem Schluss, dass die rechtliche Verurteilung allein nicht ausreiche, und fordert daher umfassende Aufklärungs- und Bildungsprojekte.
Der Unicef-Bericht steht in englischer Sprache im Netz unter: Female Genital Mutilation/Cutting