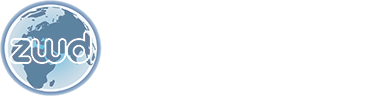Am 20. Februar entscheiden die BürgerInnen in Schleswig-Holstein bei der Landtagswahl auch über die neue Schulstruktur Ihres Landes. SPD und Grüne wollen das gegliederte System überwinden und den Wechsel zum längeren gemeinsamen Lernen einleiten. Die CDU versucht, mit einer Kampagne Stimmung gegen das Vorhaben zu machen. Dabei seien die Schulträger vor Ort aufgeschlossen für eine Strukturreform, unterstreicht die Bildungsministerin des Landes, Ute Erdsiek-Rave (SPD). Zum einen zwinge die demografische Entwicklung zum umdenken: Zahlreiche Standorte könnten bei fortgesetzter Trennung nach Schulformen wegen niedriger Geburtenraten nicht erhalten bleiben. Vor allem aber hätten die PISA-Ergebnisse die bildungspolitischen Schwächen des bestehenden Systems aufgezeigt, in dem zu wenig Jugendliche höhere Abschlüsse erreichen. „Wir können uns das Aussortieren nicht mehr leisten“, sagte die Ministerin im Interview. Mit ihr sprach der zwd über bildungspolitischen Chancen, demografischen Notwendigkeiten und über politische Risken des Vorhabens.
Am 20. Februar entscheiden die BürgerInnen in Schleswig-Holstein bei der Landtagswahl auch über die neue Schulstruktur Ihres Landes. SPD und Grüne wollen das gegliederte System überwinden und den Wechsel zum längeren gemeinsamen Lernen einleiten. Die CDU versucht, mit einer Kampagne Stimmung gegen das Vorhaben zu machen. Dabei seien die Schulträger vor Ort aufgeschlossen für eine Strukturreform, unterstreicht die Bildungsministerin des Landes, Ute Erdsiek-Rave (SPD). Zum einen zwinge die demografische Entwicklung zum umdenken: Zahlreiche Standorte könnten bei fortgesetzter Trennung nach Schulformen wegen niedriger Geburtenraten nicht erhalten bleiben. Vor allem aber hätten die PISA-Ergebnisse die bildungspolitischen Schwächen des bestehenden Systems aufgezeigt, in dem zu wenig Jugendliche höhere Abschlüsse erreichen. „Wir können uns das Aussortieren nicht mehr leisten“, sagte die Ministerin im Interview. Mit ihr sprach der zwd über bildungspolitischen Chancen, demografischen Notwendigkeiten und über politische Risken des Vorhabens.zwd: Frau Erdsiek-Rave, bis 2010 wollen Sie den Umbau der Schulstruktur auf den Weg gebracht haben, das gegliederte System soll einer integrativen Form nach skandinavischem Vorbild weichen. Warum setzt sich die SPD in Schleswig-Holstein an die Spitze einer Entwicklung, die zwar von Bildungsexperten überwiegend begrüßt wird, politisch aber ein hohes Risiko birgt. Kann man mit einem Gesamtschul-Modell wirklich Wahlen gewinnen?
Ute Erdsiek-Rave: Die PISA-Ergebnisse haben uns gezeigt, dass unser bestehendes Schulsystem deutliche Schwächen hat. Diese Tatsachen aber auch die in absehbarer Zeit sinkenden Schülerzahlen zwingen uns zu handeln. Deshalb setzen wir uns in Schleswig-Holstein für längeres gemeinsames Lernen ein, wie es in fast allen europäischen insbesondere aber in den skandinavischen Ländern Standard ist. Diese Länder beweisen, dass man die Kinder besser fördern und fordern kann, wenn sie länger gemeinsam lernen. Sie zeigen, dass man damit mehr Bildung für alle erreicht, dass mehr Kinder mit höheren Schulabschlüssen die Schulen verlassen.
zwd: Ist die Strukturreform also vor allem aus bildungspolitischen oder eher aus demografischen Gründen notwendig?
Erdsiek-Rave: Beide Umstände zwingen uns zu handeln. Einerseits liegen die Schwächen unseres selektierenden Systems offen zutage: Das dreigliedrige Schulsystem trennt die Kinder zu früh und oft nicht nach ihrem tatsächlichen Leistungsvermögen. Der soziale Status der Eltern spielt eine viel zu große Rolle. Bildungsaufstiege sind bei uns sehr schwierig. Deshalb haben wir im internationalen Vergleich zu wenige höhere Schulabschlüsse. Andererseits haben wir überdurchschnittlich viele Kinder, die sitzen bleiben, die aus höheren Schularten durchgereicht werden, die zu Schulversagern werden. Wir können es uns nicht leisten, dass in jedem Jahrgang ein Viertel der Jugendlichen „aussortiert“ wird. Gleichzeitig müssen wir die Schullandschaft neu strukturieren und in dünn besiedelten Gebieten und Regionen mit extrem rückläufigen Schülerzahlen können wir die Schulstandorte nur durch Kooperationen sichern. Das wissen übrigens die Schulträger vor Ort schon lange und handeln entsprechend: Neun Prozent der allgemein bildenden Schulen in Schleswig-Holstein sind bereits Kooperationsmodelle.
zwd: Wie viel Zeit benötigt eine solche Reform bis sie Wirkung zeigen kann?
Erdsiek-Rave: Ich habe immer gesagt, das der Umbau unseres Schulsystems Zeit braucht. Da kann man nicht einfach einen Hebel umlegen. Wir brauchen ein Jahrzehnt der Kooperation, in dem wir sukzessive vorgehen und dies mit allen Beteiligten - mit den Schulen, den Lehrkräften, den Schulträgern, den Schülern und vor allem auch gemeinsam mit den Eltern.
zwd: Die CDU macht derzeit Wahlkampf mit einer angeblichen Liste von Schulen, die geschlossen oder zwangsweise in Gemeinschaftsschulen umgewandelt werden sollen. Wer trifft die Entscheidung, ob und wann sich eine Schule umwandelt und wie stark ist die Neigung dazu vor Ort in den Kommunen ausgeprägt?
Erdsiek-Rave: Was die CDU da macht ist weder seriös noch konstruktiv. Solche Äußerungen sind nur dazu angetan, Panik zu schüren. Wir haben jedenfalls keine Liste in der Schublade und im Übrigen fallen Entscheidungen über künftige Kooperationen von Schulen nur in enger Abstimmung mit den Schulträgern. Und da stelle ich fest, dass vieles schon passiert auf Initiative der Schulträger, die über den nötigen Weitblick verfügen und vorausschauend ihren Schulstandort sichern wollen.
zwd: Sie wollen in der „Schule für alle“ sämtliche Schulformen zusammenführen. Warum gehen Sie nicht den Weg Brandenburgs, wo nur Gesamt-, Real- und Hauptschulen zur neuen „Oberschule“ zusammengefasst werden, Gymnasien aber bestehen bleiben?
Erdsiek-Rave: Nach der sechsjährigen Grundschule können die Kinder in Brandenburg wählen zwischen Gymnasium, Gesamtschule mit Gymnasialzweig und der neuen Oberschule. Brandenburg bekennt sich damit weiter zum dreigliedriges Schulsystem. Wir dagegen orientieren uns an dem skandinavischen Vorbild - und dort gibt es eine Schule für alle bis zur zehnten Klasse, in der die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler individuell gefördert werden können. PISA hat uns gezeigt, wie erfolgreich dieses System ist.
zwd: Die Leistungs-Heterogenität in den Klassen wird in einer „Schule für alle“ noch zunehmen. Wie kann dennoch eine individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers stattfinden? Welche Konsequenzen müssen sich für die Lehrkräftebildung und die Lerngruppen-Größen ergeben?
Erdsiek-Rave: Binnendifferen-zierten Unterricht gibt es ja schon zum Beispiel in unseren Grundschulen, wir müssen diese Formen aber noch entschieden ausbauen. Dazu gehört natürlich auch eine entsprechende Ausbildung der Lehrkräfte. Dabei hilft uns nicht zuletzt auch die Reform der Lehrerbildung, die wir in Schleswig-Holstein bereits in Angriff genommen haben, und bei der die Stärkung der praktischen Ausbildung ein wesentlicher Bestandteil ist.
zwd: Erwarten Sie, dass Ihnen – sollte die SPD in Schleswig-Holstein die Wahl gewinnen – weitere sozialdemokratisch geführte Bundesländer bei den Strukturreformen folgen werden?
Erdsiek-Rave: Ich bin zuversichtlich, dass die Gruppe derer in Deutschland, die sich für einen Wandel unseres Schulsystems einsetzt mit der Zeit größer wird. In Mecklenburg-Vorpommern ist man übrigens auch schon auf diesem Weg. Bildung ist der wichtigste Rohstoff, den wir haben. Wenn wir im globalen Wettbewerb bestehen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass mehr Jugendliche höhere Abschlüsse erwerben und dass wir weniger Schulversager haben. Ich bin überzeugt, es wird mehr und mehr Zustimmung zu diesem Weg geben - nicht nur in den Parteien, sondern auch in der Wirtschaft, bei Eltern, in der Bevölkerung insgesamt.
Interview: Jan Almstedt
zwd-Übersicht: Die bildungspolitschen Schwerpunkte in den Wahlprogrammen der Parteien (BWK 02/2005)