Haben Sie Probleme beim lesen dieser E-Mail Lesen Sie die Onlinevariante
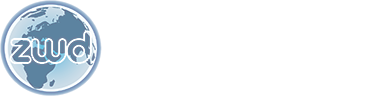 zwd-Newsletter FRAUEN & POLITIK DIGITAL 03-20 i.V.m. Ausgabe 378 D |
|
Corona-bedingt verzögert informieren wir Sie heute über die Digitalausgabe des zwd-POLITIKMAGAZINs 378 D zum Bereich FRAUEN & POLITIK Wie Sie vielleicht auf unserer Portal-Seite www.zwd.info gesehen haben, können Abonnent*innen diese Ausgabe im PDF-Format herunterladen (Link am Ende dieser Mail). Von 2020 an erscheint das POLITIKMAGAZIN sowohl als Printausgabe als auch DIGITAL mit den getrennten, teilweise ergänzenden Inhalten zu den Themenbereichen FRAUEN & POLITIK (Frauen- und Gleichstellung, Gesundheit, Kultur und Gesellschaft) sowie BILDUNG & POLITIK (Bildung, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft). Leser*innen mit dem kombinierten Print- und Online-Abonnement haben wie gewohnt auch auf die neuen Digitalausgaben Zugriff. Eine Übersicht über die Bestellmöglichkeiten erhalten Sie mit dem Link zu den Abo-Modellen unten. |
|
Im Mittelpunkt dieses Newsletters steht die neue Digitalausgabe des zwd-POLITIKMAGAZINs"FRAUEN & POLITIK 378 D"
Pandemie-bedingt ist diese Ausgabe auf die Situation von Frauen in der Corona-Krise und Auswege aus der Krise fokussiert. Die Titelgeschichte gilt der Frage, ob die Politik in der Lage sein wird, für einen geschlechtergerechten Umgang mit der Corona-Krise zu sorgen. zwd-Herausgeber Holger H. Lührig befasst sich mit verschiedenen Initiativen aus Wissenschaft und von führenden Frauenorganisationen. Sie alle verlangten vom Bund und den Ländern, dem Rückfall in längst überwunden geglaubte Rollenklischees in Familien als Folge der Corona-Pandemie entgegenzutreten. In diesem Zusammenhang wird auch das milliardenschwere Konjunkturprogramm unter geschlechterpolitischen Gesichtspunkten unter der Fragestellung beleuchtet: Inwiefern sind die Maßnahmen der Regierung tatsächlich an dem von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) betonten Grundsatz "Keine Staatshilfen ohne Frauenförderung" ausgerichtet? Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe beschäftigt sich vor dem Hintergrund des Kriegsendes am 8. Mai 1945 mit der häufig durch das Schlagwort der "Trümmerfrauen" stilisierten Frauengeneration der Nachkriegszeit. zwd-Chefredakteurin Hilda Lührig-Nockemann geht dem in der früheren DDR und von der westdeutschen Frauengeschichtsschreibung geschaffenen Mythos nach: In der Realität war der überwiegend weiblich geprägte Wiederaufbau in der Realität nach heutigen historischen Erkenntnissen regional und zeitlich begrenzt,. Aber Frauen, die in der Nachkriegszeit unzählige Traumatisierungen erdulden mussten, leisteten einen Hauptteil der Überlebensarbeit und übernahmen Verantwortung. In beiden deutschen Teilstaaten entwickelten sich emanzipatorische Bestrebungen. Protagonistinnen der Gleichberechtigung in Ost und West mit ihre unterschiedlichen frauenpolitischen Sichtweisen stellt Lührig-Nockemann im Text einander gegenüber. Der Situation von Frauen und Kindern in der Corona-Krise widmet sich unsere Redaktionskollegin Ulrike Günther. Frauenhäuser sehen sich besonderen Herausforderungen gegenüber. Eine neue Förderleitlinie des Bundesfamilienministeriums soll die Einrichtungen finanziell absichern und für eine angemessene technische Ausstattung sorgen. Unterdessen meldete das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" einen drastischen Anstieg der Beratungsgespräche zu häuslicher Gewalt. Denn das während der Kontaktsperre erzwungene Begrenztsein von Ehepaaren und Familien auf die Privatsphäre erzeugt Stress, schwelende Konflikte eskalieren. Kinder haben unter den Schutzmaßnahmen ganz besonders zu leiden. Ausgangsbeschränkungen, drohende Arbeitslosigkeit und Online-Unterricht verschärfen teilweise die in manchen Familien herrschende Spannung. Häufiger als sonst nehmen Kinder und Jugendliche Kontakt zu Hilfetelefonen auf, die Anzahl der Anfragen bei der medizinischen Kinderschutz-Hotline ist gestiegen. Alarmierte Politiker*innen wie Kinderhilfswerke fordern, Kinder vor der erhöhten Gefahr von Gewalt im häuslich-familiären Umfeld zu schützen, Die Kriminalstatistik für 2019 belegt, dass Gewalt gegen Kinder auch außerhalb der Krise ein dringliches Problem darstellt. Vor allem sexuelle Gewalt, Missbrauch und Straftaten auf dem Feld der Kinderpornographie haben in einem erschreckenden Maße zugenommen. Politiker*innen mehrerer Fraktionen wollen Prävention und Strafverfolgung verbessern, Kinderschutzorganisationen Schutz und Teilhabe von Kindern durch Kinderrechte im Grundgesetz stärken. Eine aktuelle OECD-Studie beschreibt die Rolle der Frauen weltweit im Kampf gegen die Corona-Pandemie: Als Krankenschwestern, Pflegerinnen oder Verkäuferinnen befinden sie sich im Zentrum des Krisengeschehens und tragen die Hauptlast der systemrelevanten Aufgaben. Gleichzeitig sind sie stärker dem Risiko der Erkrankung und der Gefahr ausgesetzt, Opfer häuslicher Gewalt zu werden. Die Politik sollte nach Auffassung der OECD-Forscher*innen gezielte Maßnahmen ergreifen, um die ungünstigen geschlechtsspezifischen Folgen der Krise einzudämmen. Die zwd-Redaktion wünscht Ihnen eine spannende Lektüre! Sie können die aktuelle Ausgabe im PDF-Format hier herunterladen.
Noch kein*e Abonnent*in? Eine Übersicht unserer Abo-Modelle finden Sie hier.
|
| zwd-Nachrichten |
|
|
| Lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe unter anderem: |
Die Themen der DIGITALAUSGABE FRAUEN & POLITIK 378 D:Kommentar (Holger H. Lührig): "Retraditionalisierung" Rolle rückwärts in die 50er Jahre oder geschlechtergerecht aus der Krise? FRAUEN & CORONACOVID-19-PANDEMIE: Keine Staatshilfen ohne Frauenförderung BUNDESTAGREGIERUNGSBEFRAGUNG: Liebe Frau Bundeskanzlerin, ... was wollen Sie als Chefin der Bundesregierung konkret gegen den Rückfall in eine traditionelle Rollenverteilung tun? GESCHLECHTERGERECHTE CORONA-FINANZHILFEN: Am 17. Juni: 30 Minuten Gleichstellungsdebatte GLEICHSTELLUNGSPOLITISCHER AUFRUF VON 20 FRAUENORGANISATIONEN: Wann, wenn nicht jetzt? FRAUEN & GESELLSCHAFTCORONA-EPIDEMIE: Neue Förderleitlinie unterstützt Frauenhäuser HÄUSLICHE GEWALT UND CORONA-KRISE: Mehr Frauen suchen über Hilfetelefon Rat INTERNATIONALE FRAUENPOLITIKOECD-STUDIE CORONA-EPIDEMIE: Frauen übernehmen Hauptlast, sind am meisten gefährdet: Was daraus für die Politik folgt GESELLSCHAFT & POLiTIKFOLGEN CORONA-EPIDEMIE: Gefährliche Krise: Anstieg bei Gewalt gegen Kinder befürchtet KINDERRECHTE UND PRÜGELSTRAFE: Geprügelte Kinder: „Sei gehorsam - sonst setzt es was!“ DEUTSCHLAND NACH DEM 8. MAI 1945DIE TRÜMMERFRAUEN, EIN MYTHOS: Ein Aufbruch aus den traditionellen Frauenrollen NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG: Zwei Staaten, zwei Antworten auf die Gleichstellung von Mann und Frau GLEICHBERECHTIGUNG DER FRAUEN: Zweimal West und zweimal Ost: Vier Vorkämpferinnen für die Gleichberechtigung der Frau in West- und Ostdeutschland FRAUEN & GESELLSCHAFT16 BUNDESTAGSABGEORDNETE FORDERN: Verbot der Prostitution
|
|
Newsletter Bezieher*innen, die dieses Angebot nicht mehr nutzen wollen, können sich mit folgendem Link austragen lassen: Newsletter abmelden | Newsletter Resorts anpassen |
|
Abonnent*innen bitten wir, entsprechende Änderungen in Ihrem Userprofil vorzunehmen. Sie gelangen in das Userprofil, indem sie sich in einem der beiden Portale einloggen und in der rechten Navigation auf "Userprofil" klicken. Dort können Sie dann entsprechende Änderungen vornehmen. Herausgeber aller Newsletter ist die zwd-Mediengruppe (zwd-Mediengesellschaft mbH in Kooperation mit der zweiwochendienst Verlags-GmbH). Verantwortlich i.S.d.P ist: Holger H. Lührig Anschrift: zwd-Redaktion Müllerstraße 163 13353 Berlin Tel: 030-50 60 33 88 Fax: 032-12 740 0757 redaktion@zwd.info |
