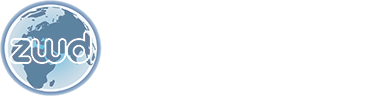zwd Berlin. Die Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums Potsdam Prof.in Miriam Rührup hält es für möglich, bei der Resolution könne es sich eher um eine „Beschwichtigungsformel“ gegen den zu beobachtenden „Rechtsruck in der Gesellschaft“ handeln als eine wirksame Strategie gegen Antisemitismus. In der Diskussion zum fraktionsübergreifenden Antrag in der Bundespressekonferenz (BPK) vom 30. Januar befürwortete sie ganz eindeutig dessen „positive Motivation“. Sie kritisierte jedoch, dass es aus ihrer Sicht für ein tatsächliches Bekämpfen von Antisemitismus unerlässlich sei, die „Vielfalt von jüdischen Stimmen“ und die „Vielfalt in der Gesellschaft überhaupt“ anzuerkennen. Schulen und Universitäten seien in religiöser, politischer, sexueller Hinsicht divers. Auf diese vielfältige Zusammensetzung müsse man „mit diversen Instrumenten“ antworten. An Hochschulen, in denen sich laut Rührup gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzungen widerspiegelten, sollte man „politische Kontroversen“ zulassen, „freie Diskurse“ ermöglichen.
Akademiker:innen: Autoritäre Maßnahmen könnten Wissenschaftsfreiheit begrenzen
Der Leiter der Abteilung Global Governance vom Wissenschaftszentrum Prof. Michael Zürn bemängelte an dem Fraktionsvorhaben, dessen Zielsetzung er prinzipiell für sinnvoll erachtet, es könnte die Wissenschaftsfreiheit begrenzen und die Hochschulautonomie beschädigen, „normativen Erwartungen“ aus dem Antrag stünden „wertvolle Güter“ entgegen, die man nicht einfach aufgeben sollte. Der Jurist Prof. Ralf Michaels, Direktor des Max Planck Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht kritisierte, ähnlich wie die Linken, die in der Resolution empfohlenen Mittel als autoritär: „Überwachung, Repression, Sicherheitsbehörden“. Er zitierte den Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) Prof. Walter Rosenthal, der bereits im November 2024 in Reaktion auf den Vorschlag der Antragsteller:innen zu bedenken gab, die entworfenen Methoden könnten als „Einfallstor für Einschränkungen und Bevormundungen, etwa in der Forschungsförderung“ verstanden werden. Die Kulturanthropologin Prof.in Aleida Assman, welche die von den Akademiker/innen bevorzugte sog. Jerusalemer Erklärung mit entwickelt hat, erklärte, diese würde stärker als die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) zwischen legitimer Kritik an der israelischen Regierungspolitik und einer Infragestellung des Existenzrechts des Staates Israel unterscheiden.
Die Grünen: Meinungsrecht darf kein Freifahrschein für Antisemitismus sein
Dass es „unerträglich“ ist, wenn sich jüdische Schüler:innen auf dem Weg zum Unterricht, jüdische Studierende auf dem Uni-Campus nicht mehr sicher fühlen, wie es der Vorsitzende des Bildungsausschusses Kai Gehring (Die Grünen) formulierte, dass der „Kampf gegen Antisemitismus“ in den Worten des bildungspolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion Oliver Kaczmarek überall in der Bundesrepublik „eine immerwährende Verantwortung für die deutsche Politik“ bleibe, darüber herrschte unter den rot-grün-schwarz-gelben Antragsteller:innen im Grunde Konsens. Angesichts von antisemitischer Gewalt an Hochschulen, rechtsextremen Jugendlichen, Leugnen der Nazi-Verbrechen gebe es „immer noch politischen Handlungsbedarf“, konstatierte die Sozialdemokratin Maja Wallstein, „um die Lehren aus der Geschichte tragen zu können".
Schulen und Universitäten sollten „safe spaces“ sein, in denen „jede und jeder ohne Angst, frei und sicher verschieden sein kann“, betonte Grünen-Politiker Gehring in der Bundestagsdebatte zum interfraktionellen Antrag gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Schulen und Hochschulen (Drs. 20/ 14703) am 29. Januar. Er berief sich auf Artikel 1 des Grundgesetzes (GG), der menschliche Würde als unantastbar geltend macht und laut Gehring alle gleichermassen schütze. Die Achtung der Würde jedes Menschen sei echter Verfassungsschutz und eine Frage des „Anstand(s)“. Der grüne Hochschulpolitiker erklärte, „Meinungs-, Versammlungs- und Wissenschaftsfreiheit“, die häufig vermischt würden, bedeuteten keinen „Freifahrschein für Antisemitismus“. Protest gehöre zwar zu einer „lebendigen Demokratie“, jedoch nicht „organisierte Verrohung oder Radikalisierung“. Anstatt „Hochschulen als Kampfzonen zu instrumentalisieren“, sollte man sie „in ihrer Diskursrolle stärken“. Mit Blick auf vorhandene, „zu groß(e)“ Forschungslücken zu jüdischer Gegenwartsforschung trat Gehring dafür ein, ein Institut mit diesem Aufgabenbereich zu gründen.
SPD: Wichtiges Bekenntnis zu jüdischem Leben
Der Antrag beinhalte ein wichtiges, deutliches „Bekenntnis zu jüdischem Leben“, hob SPD-Politiker Kaczmarek hervor. Man beabsichtige u.a., „Prävention und politische Bildung“ zu stärken, wozu er auch die Gedenkstättenkultur zählt. Hochschulen seien als „Orte des offenen Diskurses zu erhalten“, das setze jedoch voraus, die Grenzen eines solchen Diskurses anzuerkennen. Dessen Freiheit würde durch die „Anwendung von Gewalt, (...) Verbreitung von Antisemitismus und auch (…) Infragestellung des Existenzrechts des Staates Israel“ eingeschränkt. Wissenschaftsfreiheit sei „nicht verhandelbar“, unterstrich Kaczmarek. Bildungsausschuss-Mitglied Daniela Ludwig (CDU) forderte, man müsse „die Antisemitismus-Forschung deutlich ausweiten“, ebenso mehr „Wissen um jüdisches Leben“, jüdische Kultur und die Entwicklung des israelischen Staates vermitteln.
Unter Bezugnahme auf das „brutale Massaker der Terrororganisation Hamas“ in Israel am 07. Oktober und den Krieg in Gaza, die den Nahost-Konflikt besonders an den Schulen und Universitäten wieder ins Zentrum gerückt hättten, stellt das Fraktionen-Bündnis in dem Antragsschreiben fest, jüdische Schüler:inen, Student:innen, Lehrkräfte sähen sich zunehmend „Anfeindungen und Bedrohungen“ ausgesetzt, bei „Proteste(n) und Protestcamps“ würden „antisemitische und antiisraelische Parolen“ verbreitet. Daher fordern die Parlamentarier:innen die Bundesregierung auf, Antisemitismusforschung weiterzuentwickeln und zu stärken, Projekte zu jüdischer Gegenwartsforschung vermehrt zu fördern. Die Regierung solle zusammen mit den Bundesländern darauf hinwirken, dass Kultusministerkonferenz (KMK), Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) sowie Hochschulrektorenkonferenz (HRK) für ein konsequentes Vorgehen gegen antijüdisches Verhalten sorgen und Schulen wie Hochschulen unterstützen, „ihre rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen“. Der vorliegende Antrag ergänzt und spezifiziert für den schulischen und hochschulischen Bereich allgemeine Forderungen aus der - von Fachleuten ebenfalls kontrovers diskutierten - Resolution derselben Fraktionen zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland (Drs. 20/ 13627, zwd-POLITIKMAGAZIN berichtete), welche der Bundestag Fraktionen am 07. November 2024 bewilligte.
FDP: Kampfansage gegen systematisches Erzeugen von Unsicherheit
Die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion Ria Schröder unterstrich, der fraktionsübergreifende Antrag stelle einen „Ausdruck unserer Verantwortung gegenüber Menschen jüdischen Glaubens in unserem Land“ dar. Sie referierte Daten des Bundeskriminalamts (BKA), wonach 30 Prozent der Straftaten im Gebiet Hasskriminalität 2024 einen „antisemitischen Hintergrund“ hatten. An Hochschulen gebe es nicht mehr Antisemit:innen als in der übrigen Gesellschaft, nach Schröders Ansicht seien Universitäten in Deutschland wie international allerdings „in besonderer Weise für Judenhass missbraucht“ worden. Das Fraktionsvorhaben bilde eine „Kampfansage“ an alle diejenigen, die aktiv versuchten, an schulischen und hochschulischen Einrichtungen „systematisch ein Klima der Angst und Unsicherheit“ zu erzeugen und eine „antisemitische Deutungshoheit über den Nahost-Konflikt“ zu etablieren.
Unions-Politikerin Monika Grütters prangerte die bei antiisraelischen Protesten an Hochschulen, die auch auf den Gebrauch von Terrorsymbolen zurückgriffen, zutage getretene „Hilflosigkeit der Autoritäten“, in erster Linie der Universitäten, an und setzte sich für „professionelle Antisemitismusbeauftragte“ sowie einen „strukturierten Dialog zwischen den Unis und den deutschen Sicherheitsbehörden“ ein. Für das „Spannungsfeld“, die „gesamtgesellschaftliche Balance zwischen Meinungsfreiheit, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit“ auf der einen Seite und „der klaren Antwort auf Hass, Spaltung, Hetze, Rassismus und Antisemitismus andererseits“, sind aus ihrer Sicht Wissenschaftspolitik, Hochschulleitungen und auch das Parlament zuständig. Die Antragsteller:innen befürworten ausdrücklich, dass KMK, HRK und Bundestag die Definition von Antisemitismus der IHRA in früheren Beschlüssen als maßgeblich anerkannt haben, und sprechen sich dafür aus, diese an Schulen und Universitäten einheitlich anzuwenden. Überdies schlagen sie vor, die gemeinsam vom Zentralrat der Juden und der Bund Länder-Kommission erarbeitete Empfehlung zu Antisemitismus im schulischen Milieu folgerichtig umzusetzen, wozu u.a. Bekämpfen von antijüdischem Verhalten, Besuch von Gedenkstätten und intensives Vermitteln von Kenntnissen zu Antisemitismus und Judentum gehörten.
Linke: Maßnahmen teilweise fragwürdig und autoritär
Die linke Bildungs-Politikerin Nicole Gohlke monierte, die Fraktionen hätten bei ihrem Antrag zu wenig Finanzmittel eingeplant. Bekämpfen von Antisemitismus an schulischen und hochschulischen Bildungseinrichtungen befürwortete sie als „wichtiges Thema“, bescheinigte aber dem Vorhaben, es umfasse auch einige „fragwürdige und autoritäre Maßnahmen", vor allem habe man keine Sachverständigen zu Rate gezogen, kritische Einwände nicht berücksichtigt. In der Bundesrepublik sei „ein dramatischer Anstieg von Antisemitismus und auch von Rassismus“ zu beobachten, beides könne man nach Auffassung von Gohlke bloß gemeinsam bekämpfen. Ähnlich wie BSW-Politiker Andrej Hunko beanstandete sie, die antragstellenden Fraktionen würden der Forschung eine bestimmte Definition von Antisemitismus vorgeben, obwohl diese eigentlich Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung sei.
Hunko wies darauf hin, die dem Antrag zugrunde gelegte Bestimmung des Begriffs sei nicht unumstritten, und verwies auf die sog. Jerusalemer Erklärung. Diese enthält 15 Richtlinien und wurde im März 2021 als Alternative zur – als teilweise unpräzise, zu deutungsoffen bemängelten - IHRA-Definition von einer Arbeitsgruppe aus Fachleuten zur Geschichte der Shoah, zu jüdischen und Nahost-Studien entworfen und von über 370 Akademiker:innen unterzeichnet. Die Antragsteller:innen versuchten, eine „staatliche Antisemitismus-Diskussion“ mit „autoritären Mitteln“ durchzusetzen. Wie Gohlke befürchtet der BSW-Abgeordnete, dass dadurch auch eine „legitime Kritik“ an der Pollitik der israelischen Regieruung unter den Vorwurf des Antisemitismus geraten und den Diskurs von Meinungen einengen könnte. Weitere Forderungen aus dem Fraktionsantrag an die Koalitionsregierung betreffen Forschungsergebnisse, die in die Praxis zu übertragen seien, um einen „qualitativ hochwertige(n) Unterricht“ zu den Weltreligionen, dem Nahost-Konflikt, Staat Israel, zu jüdischer Geschichte und jüdischem Leben in der Bundesrepublik sicherzustellen und „religiösem Fanatismus d(en) Nährboden“ zu entziehen. Die Regierung solle außerdem den im Dezember 2023 von der KMK beschlossenen „Aktiionsplan gegen Antisemitismus“ an Hochschulen befolgen, der u.a. Sensibilisieren von Lehrenden für das Phänomen, breitere Angebote für ein gestärktes Geschichtsbewusstsein, Überprüfen von Sicherheitskonzepten sowie Einrichten von Foren zur interkulturellen und interreligiösen Begegnung vorsieht.
Der Antrag wurde mit den Stimmen aller Fraktionen angenommen, die Linken enthielten sich, das BSW votierte dagegen.
Ausführlich: Bundestagsresolution zu Antisemitismus an Schulen und Hochschulen bleibt nicht unumstritten
(zwd-POLITIKMAGAZIN, Ausgabe 406)