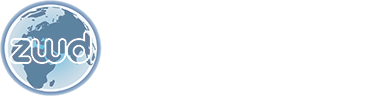zwd Wiesbaden/Frankfurt am Main. Dies geht aus dem aktuellen Bildungsfinanzbericht hervor, der am Donnerstag vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlicht wurde. Er wird ein Mal jährlich im Auftrag des Bundesbildungsministeriums (BMBF) und der Kultusministerkonferenz (KMK) erstellt.
Demnach floss im vergangenen Jahr mit 66,1 Milliarden Euro knapp die Hälfte der öffentlichen Bildungsausgaben in die Schulen. Rund 30,5 Milliarden Euro entfielen auf Hochschulen und 26,6 Milliarden Euro auf Kindertageseinrichtungen. Gegenüber 2010 war die Kindertagesbetreuung mit einem Plus von 68,7 Prozent der Bildungsbereich mit den höchsten Ausgabensteigerungen. Dieser Anstieg ist vor allem auf das von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam finanzierte Investitionsprogramm zum Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen zurückzuführen. Im Hochschulbereich stiegen die öffentlichen Ausgaben gegenüber 2010 um 35,4 Prozent. „Haupttreiber“ für den Ausgabenanstieg in diesem Bildungsbereich war der Hochschulpakt, mit dem das Studienangebot für die steigenden Studierendenzahlen ausgebaut wurde.
Anteil des Bundes bei sieben Prozent
Die Zunahme der Ausgaben im Schulbereich um 11,9 Prozent ist das Ergebnis gegenläufiger Entwicklungen. Während Maßnahmen wie der Ausbau des Ganztagsschulangebots für höhere Ausgaben sorgten, führte die Verringerung der Anzahl der Schüler in einzelnen Ländern und Schulbereichen zu geringeren Ausgaben. Insgesamt lagen die öffentlichen Bildungsausgaben 2017 um 25,6 Prozent über dem Stand von 2010.
An den öffentlichen Bildungsausgaben 2017 beteiligten sich der Bund mit 10,6 Milliarden Euro, die Länder mit 94,3 Milliarden Euro und die Gemeinden mit 28,5 Milliarden Euro. Die durchschnittlichen öffentlichen Bildungsausgaben je Einwohner*in unter 30 Jahren betrugen rund 5.300 Euro. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung wurden rund 1.600 Euro pro Kopf für Bildung ausgegeben.
Ansgar Klinger, Vorstandsmitglied für Berufliche Bildung und Weiterbildung bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnte, die Rekordzahlen dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Bildungswesen in Deutschland weiterhin dramatisch unterfinanziert sei. Gemessen an seiner Wirtschaftskraft gebe Deutschland nicht nur weniger Geld aus als die OECD-Staaten im Schnitt, sondern auch als die Staaten der Europäischen Union. Laut Klinger mache der Bericht noch auf ein weiteres Finanzierungsproblem im deutschen Bildungsföderalismus aufmerksam: „Der Bund zahlt gerade einmal 7 Prozent. Das Kooperationsverbot muss weiter gelockert werden, damit sich dieser mit zusätzlichen Mitteln in der Bildung engagieren kann.“