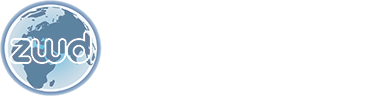Bei allem Engagement von zumal vielen jungen Menschen für Demokratie, Klimaschutz und Gerechtigkeit müssen wir konstatieren, dass es nicht nur im Osten, sondern mittlerweile in ganz Deutschland das Erstarken einer rechten Jugend gibt, nationalistisch, antidemokratisch, eher in der Fläche, eher nicht akademisch, deutlich chauvinistisch und medial erhitzt. Das wird vor allen Dingen die SPD und die „demokratische Mitte“ über den Wahltag hinaus nachdrücklich beschäftigten müssen.
Umso mehr muss es dann gelten: Wenn die Demokratie eine Gesellschaftsordnung ist, die gelernt werden muss, und Demokratie ohne eine weit überwiegende Mehrheit überzeugter Demokraten nicht funktionieren kann, sind jetzt dringlich ein paar Hausaufgaben zu erledigen. In einer Lage, die absehbar durch zunehmende gesellschaftliche Komplexität, geschürten Demokratieverdruss, Krisenangst und Zukunftskonkurrenz, kulturelle Fremdheit und mediale Blasenbildungen nicht leichter werden wird, müssen klare Prioritäten für politische Bildung und das Lernen von Demokratie in den Schulen gesetzt werden.
1. Für mehr Zeit, geöffnete Räume und konkrete Erfahrungen
Nach einer Untersuchung der Universität Bielefeld macht das Fach Politik in manchen Bundesländern nicht einmal ein Prozent der schulischen Lernzeit aus. Und selbst wenn es in einzelnen Bundesländern mehr als 4 Prozent sein sollten, darf diese Unterschiedlichkeit nicht länger stillschweigend hingenommen werden. Politik taugt nicht als randständiges Schulfach. Es muss schleunigst und im Konsens aufgewertet werden – von der Grundschule an aufsteigend und in altersgerechter Weise in andere Unterrichtsfächer hinein. Wir brauchen die Öffnung von sozialen und geistigen Räumen für politisches Denken und Handeln – durch konkrete Handlungsbezüge, verbundene Lebenswirklichkeiten und die Integration persönlicher Erfahrungen – gerade und erst recht angesichts einer diverser denn je werdenden Schülerschaft.
Im Übrigen: Schülerselbstverwaltung und schulische Mitbestimmung, Debattenclubs, „Jugend forscht“ - Projekte für Politik, Gesellschaft, Umwelt und lokale wie globale Partnerschaften aller Art sind nicht von gestern. Sie sind der Humus, auf dem ein lebendiger Politikunterricht überhaupt erst wachsen kann.
2. Für mehr kompetente und engagierte Lehrkräfte, auch als Vorbilder
Aus den Hattie-Studien haben wir gelernt, welche große Bedeutung fachlich gut ausgebildete und engagierte Lehrkräfte für die Schülerleistungen haben. Wenn Politik als Fach und als Thema in andere Fächer integriert sein Potential für die Demokratiebildung optimal ausschöpfen soll, braucht es gut ausgebildete Lehrkräfte. Von Bayern wissen wir, dass dort in der Lehramtsausbildung alle Referendare die bisher bundesweit einzigartigen Sitzungen für „Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung“ besuchen müssen. Und auch die dort geplante wöchentliche „Verfassungsviertelstunde“ wird nicht nur von Politik-Lehrkräften erbracht werden können. Selbst wenn das Verhetzungspotential gegen eine vermeintliche „Staatsindoktrination“ groß sein wird: Angesichts der Bedeutung von politischer Bildung und von „Demokratie Lernen“ in der Schule sollte hierzu eine verpflichtende Lehrerfortbildung für alle in Angriff genommen werden.
Natürlich lernen Kinder und Jugendliche auch über Vorbilder. Wenn Lehrkräfte selbst politisch aktiv sind, z.B. in der kommunalen Politik oder im ehren-amtlichen zivilgesellschaftlichen Engagement hat auch dies eine positive Ausstrahlung in die Schule hinein. Wir müssen mehr Lehrkräfte dazu gewinnen, die Demokratie ganz selbstverständlich in die Schule „hinein zu leben“.
3. Für einen erweiterten didaktischen Konsens – „Beutelsbach“ reloadad
In einer starken Demokratie werden Konflikte offen bearbeitet und über Mehrheiten zu Entscheidungen geführt. Kompromisse und Konsens gehören zur Verantwortungsethik einer Demokratie der mündigen Bürger dazu. Der Beutelsbacher Konsens, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts von Pädagog:innen aller Couleur formuliert, hat dazu Regeln als Minimalkonsens für die Praxis der politischen Bildung in öffentlicher Verantwortung formuliert. Seine immer noch gültigen drei didaktischen Elemente sind
1) das Überwältigungsverbot und der Verzicht auf jede Indoktrination,
2) die Beachtung von Kontroversen in Wissenschaft und Politik und die Befassung mit Alternativen und
3) die Befähigung der Schülerinnen und Schüler, die vorgefundene politische Lage im Sinne eigener Interessen im Rahmen des Gemeinwohls zu beeinflussen.
Angesichts von politisch extremistischen, religiös-fundamentalistischen und wahrheitsleugnenden Disparitäten in Politik, Gesellschaft, Kultur und Medien wird es jetzt notwendig werden, diese didaktische Prinzipien klar mit einer normativen Dimension zu unterlegen und so zu erweitern. In der Haltung zu menschlichen Grundrechten, zu Demokratie und zu Verfassungsgrundsätzen kann es keine Neutralität und in Bezug auf Wahrheiten und Wahrhaftigkeit keinen Relativismus geben. Hierfür müssen Lehrende als Vorbild für Lernende verantwortlich einstehen. Denn Demokratie als Verantwortungsgemeinschaft ist darauf angewiesen und erst recht darauf, dass junge Menschen dieses lernen können, von Anfang an.
Dr. Ernst Dieter Rossmann ist ständiger Autor im zwd-POLITIKMAGAZIN (Rubrik "ZWISCHENRUF"). Er war langjähriger bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und in der 19. Legislaturperiode Vorsitzender der Bundestagsauschusses für Bildung und Forschung. Rossmann ist auch Ehrenvorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbandes.